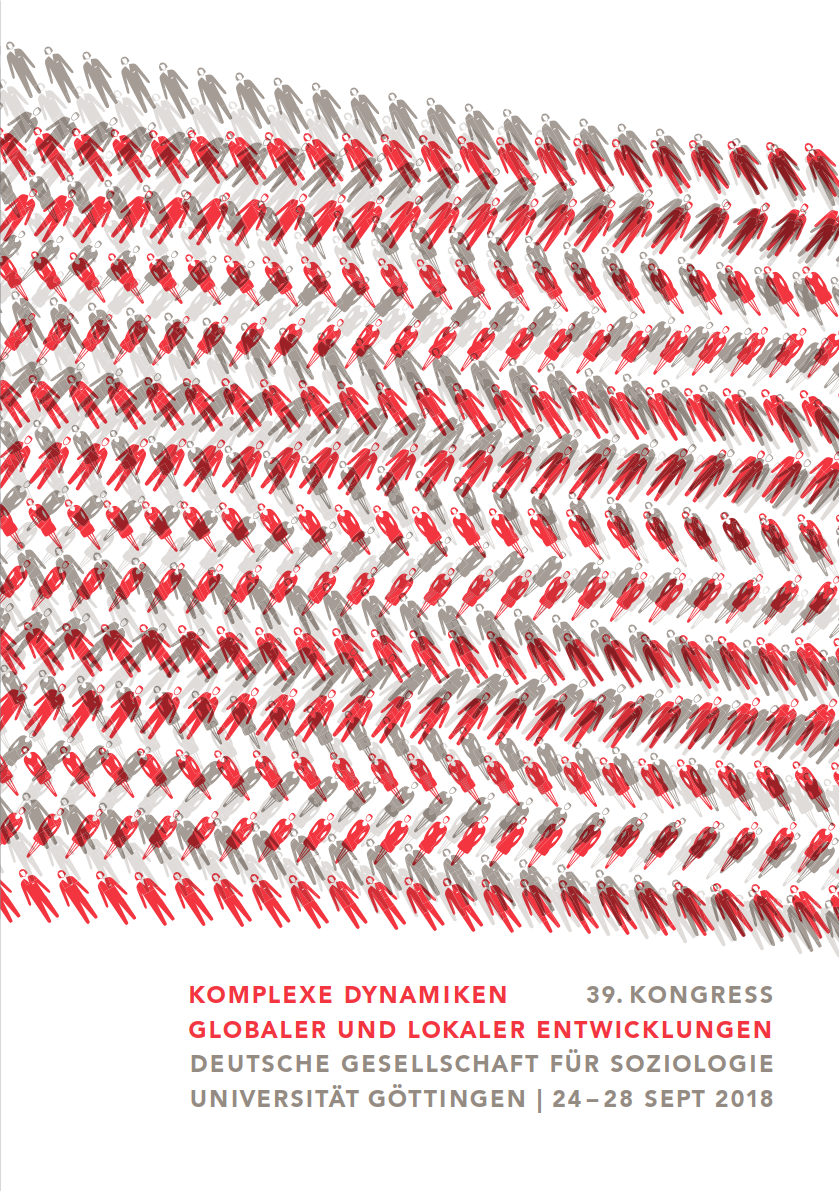Körper, Konsum und Kompetenz – Die Rolle digitaler Medien(inhalte) in der Skateszene
Schlagwörter:
Skateboarding, Skateszene, Online-MedienAbstract
Im Zuge des Medienwandels und durch die stetigen Weiterentwicklungen digitaler Technologien bleiben juvenile Vergemeinschaftungsformen nicht unberührt von kulturellen Konsequenzen der Globalisierung, denn die medientechnischen Entwicklungen im Online-Bereich bieten solchen Gemeinschaften und ihren Anhänger/innen inzwischen scheinbar grenzenlose Möglichkeiten „sich mit einem spezifischen Webangebot zu präsentieren, zu inszenieren, zu stilisieren, zu orientieren und zu vergemeinschaften“ (Hugger 2014, S.21). Folglich spielen digitale Medien und deren Inhalte auch in der Skateszene eine wichtige Rolle. Durch sie stehen vielfältige Wissensbestände zur Verfügung, die in Texte gegossen, in Fotos oder audiovisuellen Erzeugnissen eingefangen und verbreitet werden, und es erweitern sich hierdurch die individuellen wie szenekommunikativen Ausdrucks- und Austauschmöglichkeiten. Allerdings gilt zu bedenken, dass es sich hierbei um eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten handelt, die durch ähnliche Vorlieben in Bezug auf Körpermodelle, -gesten und -bewegungen miteinander verbunden sind (Alkemeyer et al. 2003, S.9) und deren Kerninteresse explizit auf physisch-reale Räume ausgerichtet ist. Entscheidend für Teilhabe und Mitgliedschaft ist die Aneignung dieser Räume, die in einem stetigen Prozess der Auseinandersetzung des Körpers mit materiellen kulturellen Artefakten erfolgt. Vor dem Hintergrund dieser spezifischen thematischen Interessenausrichtung stellt sich die Frage, was digitale Medien(inhalte) für die szenekulturellen Bedeutungskonstruktionen von Skater/innen tatsächlich leisten (können)? Hierauf bezogen gibt der Beitrag einen Überblick über die für die Skateszene wichtigsten digitalen Medien(inhalte) und lotet ihre Rolle mit Blick auf die Themen Körper, Konsum und Kompetenzen aus.
Der Beitrag basiert auf einer ethnografischen Studie zur Skateboardszene (Bock 2017; Bock 2018), in der ich der Frage nachging, wie Skateboarder/innen ihre szenekulturelle Bedeutungswelt kommunikativ konstruieren – und zwar sowohl verbal und körperlich, als auch mit den Möglichkeiten des Internets.
Literaturhinweise
Alkemeyer, Thomas, Bernhard Boschert, Robert Schmidt und Gunter Gebauer. 2003. Aufs Spiel gesetzte Körper. Eine Einführung in die Thematik. In Aufs Spiel gesetzte Körper. Aufführungen des Sozialen in Sport und populärer Kultur, Hrsg. Alkemeyer, Thomas, Bernhard Boschert, Robert Schmidt und Gunter Gebauer, 7–15. Konstanz: UVK.
Alkemeyer, Thomas. 2010. Verkörperte Gemeinschaftlichkeit. Bewegungen als Medien und Existenzweisen des Sozialen. In Die Körperlichkeit sozialen Handelns. Soziale Ordnung jenseits von Normen und Institutionen, Hrsg. Fritz Böhle und Margit Weihrich, 33–348. Bielefeld: Transkript.
Bock, Katharina. 2017. Kommunikative Konstruktion von Szenekultur. Skateboarding als Sinnstiftung und Orientierung im Zeitalter der Digitalisierung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
Bock, Katharina. 2018. Zur Rolle online-medialer Inhalte für die Skateboardkultur. In Skateboarding zwischen Subkultur und Olympia. Eine jugendliche Bewegungskultur im Spannungsfeld von Kommerzialisierung und Versportlichung, Hrsg. Jürgen Schwier und Veith Kilbert, 143–164. Bielefeld: Transcript.
Buckingham, David. 2009. Skate Perception: Self-Representation, Identity and Visual Style in a Youth Subculture. In Video Cultures: Media Technology and Everyday Creativity, Hrsg. David Buckingham und Rebekah Willett, 133–151. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Gebauer, Gunter und Thomas Alkemeyer. 2001. Das Performative in Sport und neuen Spielen. In Paragrana 10, Theorien des Performativen: 117–136.
Hugger, Kai-Uwe. 2014. Digitale Jugendkulturen. Von der Homogenisierungsperspektive zur Anerkennung des Partikularen. In Digitale Jugendkulturen, 2. Auflage, Hrsg. Kai-Uwe Hugger, 11–28. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Schwier, Jürgen und Veith Kilbert. 2018. Quo vadis Skateboarding? In Skateboarding zwischen Subkultur und Olympia. Eine jugendliche Bewegungskultur im Spannungsfeld von Kommerzialisierung und Versportlichung, Hrsg. Jürgen Schwier und Veith Kilbert, 7–13. Bielefeld: Transcript.
Stern, Martin. 2003. Heldenfiguren im Wagnissport. Zur medialen Inszenierung wagnissportlicher Erlebnisräume. In Aufs Spiel gesetzte Körper. Aufführungen des Sozialen in Sport und populärer Kultur, Hrsg. Alkemeyer, Thomas, Bernhard Boschert, Robert Schmidt und Gunter Gebauer, 37–54. Konstanz: UVK.
Witzke, Margrit. 2005. Jugendforschung mit Video-Eigenproduktionen. In Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch, Hrsg. Lothar Mikos und Claudia Wegener, 323–332. Konstanz: UVK.
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Beiträge im Verhandlungsband des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie werden unter der Creative Commons Lizenz "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" veröffentlicht.
Dritte dürfen die Beiträge:
-
Teilen: in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
-
Bearbeiten: remixen, verändern und darauf aufbauen
unter folgenden Bedinungen:
-
Namensnennung: Dritte müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden
-
Nicht kommerziell: Dritte dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen