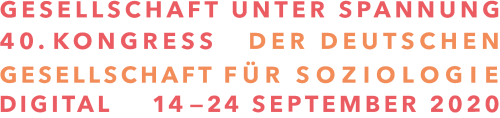Social Media und die Bedeutung von Emotionen in autoritär-nationalistischen Radikalisierungsnarrativen
Schlagwörter:
Emotionen, affektive Zustände, Autoritärer Nationalradikalismus, Rechtsextremismus, Social Media, Scham, Beschämung, Radikalisierung, Online DiskursAbstract
Radikalisierung ist derzeit viel diskutiert (z.B. Daase et al. 2019) und noch zu wenig verstanden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Radikalisierung möglichst spezifisch zu bestimmen. Radikalisierung wird daher in diesem Beitrag, in Anlehnung an Peter Neumann (2013), als eine fortlaufend stärkere Abkehr von allgemeingültigen sozialen Normen begriffen, hin zu einer sukzessiven Akzeptanz von Gewalt bei der Durchsetzung ideologischer und politischer Ziele. Eine ähnliche Definition bieten Clark McCauley und Sophia Moskalenko (2008, S.416) an: „Radikalisierung ist die Veränderung in den Überzeugungen, Gefühlen und Verhaltensweisen in Richtungen, die Gewalt zwischen Gruppen zunehmend rechtfertigt und zur Verteidigung der eigenen Gruppe Opfer einfordert“. Die relevantesten Merkmale sind demnach der Gruppenbezug, die Akzeptanz von Gewalt zur Durchsetzung von Zielen und die Prozesshaftigkeit in der Abkehr von gültigen Normen. Die Dynamik von Radikalisierungsprozessen ist hierbei nicht durch bestimmte Mechanismen determiniert, sondern weist vielmehr zahlreiche interdependente Dimensionen auf, weshalb Radikalisierung nur interdisziplinär begreifbar ist.[1] Der Fokus unserer Analyse liegt in diesem Zusammenhang auf den emotionalen Dynamiken von Radikalisierungsprozessen und hierbei insbesondere auf der Rolle von Scham und Beschämung.
Wir zeigen in dem Beitrag, dass auch im autoritär-nationalradikalen Milieu Gefühle von Scham, Demütigung und Kränkungserfahrungen kollektiv angerufen und politisch verwertet werden. Dies sind ähnliche Muster, wie sie beispielsweise auch Kriner (2018) in seinen Analysen zu islamistischen Narrativen gefunden hat. Die Scham, so unser Fazit, sollte im Mittelpunkt der Analyse von Radikalisierungsnarrativen stehen. Sie entfaltet ihre radikalisierende Wirksamkeit über ihre kollektive Kontrollfunktion in Bezug auf soziale Identitäten und Gruppenkonformität, die ihrerseits maßgeblichen Einfluss auf die Ausbildung von Radikalisierungen innerhalb von extremistischen Online-Affektkulturen haben.
[1] Siehe hierzu auch John Horgan, „From Profiles to Pathways and Roots to Routes: Perspectives from Psychology and Radicalization into Terrorism,” The Annals of the Academy of the Political and Social Sciences 618(2008):80–94; Costanza 2015; Neumann 2017.
Literaturhinweise
Benedict, Ruth. 2006. Chrysantheme und Schwert: Formen der japanischen Kultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Borum, Randy. 2011. Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories. Journal of Strategic Security 4(4):7–36.
Brady, Wiliam J., Julian A. Wills, John T. Jost, Joshua A. Tucker und Jay J. Van Bavel. 2017. Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences 114(28):7313–7318.
Bröckling, Ulrich. 2016. Man will Angst haben. Mittelweg 36 6:3-7.
Costanza, William A. 2015. Adjusting our gaze: An alternative approach to understanding youth radicalization. Journal of Strategic Security 8(1):1–15.
Conway, Maura und Michael Courtney. 2017. Violent Extremism and Terrorism Online in 2017: The Year in Review. https://www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/Year-in-Review-2018.pdf (Zugegriffen: 17. November 2020).
Daase, Christopher, Nicole Deitelhoff und Julian Junk. 2019. Gesellschaft Extrem. Was wir über Radikalisierung wissen. Frankfurt/New York: Campus.
Davey, Jacob und Julia Ebner. 2017. The Fringe Insurgency: Connectivity, Convergence and Mainstreaming of the Extreme Right. https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2017/10/The-Fringe-Insurgency-221017_2.pdf (Zugegriffen: 17. November 2020).
Döveling, Katrin, Anu A. Harju und Denise Sommer. 2018. From Mediatized Emotion to Digital Affect Cultures: New Technologies and Global Flows of Emotion. Social Media and Society 4(1).
Ebner, Julia. 2018. Wut: Was Islamisten und Rechtsextremisten mit uns machen. Darmstadt: Konrad Theiss Verlag.
Frevert, Ute. 2017. Die Politik der Demütigung. Schauplätze von Macht und Ohnmacht. Frankfurt am Main: S. Fischer.
Hafez, Mohammed M. 2007. Martyrdom Mythology in Iraq: How Jihadists Frame Suicide Terrorism in Videos and Biographies. Terrorism and Political Violence 19(1):95–115.
Heitmeyer, Wilhelm. 2018. Autoritäre Versuchungen. Berlin: Suhrkamp.
Horgan, John. 2008. From Profiles to Pathways and Roots to Routes: Perspectives from Psychology on Radicalization into Terrorism. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 618(1):80–94.
Jost, John, Pablo Barberá, Richard Bonneau, Melanie Langer, Megan Metzger, Jonathan Nagler, Joanna Sterling und Joshua Tucker. 2018. How social media facilitates political protest: Information, motivation, and social networks: Social media and political protest. Political Psychology 39, 85–118.
Kreißel, Philip, Julia Ebner, Alexander Urban und Jakob Guhl. 2018. HASS AUF KNOPFDRUCK Rechtsextreme Trollfabriken und das Ökosystem koordinierter Hasskampagnen im Netz. http://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/07/ISD_Ich_Bin_Hier_2.pdf (Zugegriffen: 17. November 2020).
Kriner, Matthew. 2018. Tackling terrorism’s taboo: Shame. Perspectives on Terrorism 12:19–31.
Matsumoto, David, Hyisung C. Hwang und Mark G. Frank. 2012. The Role of Emotion in Predicting Violence. https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/the-role-of-emotion-in-predicting-violence (Zugegriffen: 17. November 2020).
Matsumoto, David, Mark G. Frank und Hyisung C. Hwang. 2015. The role of intergroup emotions in political violence. Current Directions in Psychological Science 24(5):369–373.
McCauley, Clark und Sophia Moskalenko. 2008. Mechanisms of political radicalization: Pathways toward terrorism. Terrorism and Political Violence 20(3):415–433.
Neckel, Sighard. 1991. Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Theorie und Gesellschaft. Frankfurt am Main/New York: Campus.
Neckel, Sighard. 1999. Blanker Neid, blinde Wut? Sozialstruktur und kollektive Gefühle. Leviathan 27(2):145–165.
Neckel, Sighard. 2009. Soziologie der Scham. In: Scham, Hrsg. Alfred Schäfer und Christiane Thompson, 103–118. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag.
Neumann, Peter. 2013. Deradikalisierung durch gezielte Intervention. Aus Politik Und Zeitgeschichte 63:29–31.
Neumann, Peter R. 2017. Der Terror ist unter uns: Dschihadismus und Radikalisierung in Europa. Berlin: Ullstein.
Scheff, Thomas J. und Suzanne M. Retzinger. 1991. Emotions and Violence: Shame and Rage in Destructive Conflicts (Lexington Books Series on Social Theory). Toronto: D. C. Heath.
Sellner, Martin. 2017. Identitär! Geschichte eines Aufbruchs. Schnellroda: Verlag Antaios.
Simi, Pete und Robert Futrell. 2006. Cyberculture and the endurance of White Power Activism. Journal of Political and Military Sociology 34:115-142.
Tarrant, Brenton. 2019. The Great Replacement. Towards a new Society we march ever forwards.
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Beiträge im Verhandlungsband des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie werden unter der Creative Commons Lizenz "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" veröffentlicht.
Dritte dürfen die Beiträge:
-
Teilen: in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
-
Bearbeiten: remixen, verändern und darauf aufbauen
unter folgenden Bedinungen:
-
Namensnennung: Dritte müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden
-
Nicht kommerziell: Dritte dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen