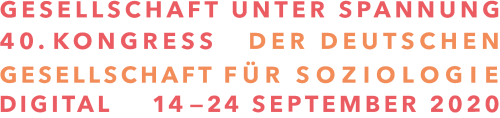Der Nationalsozialismus, »ein metaphysisches Geheimnis«?
Verrohung als blinder Fleck der Soziologie
Schlagworte:
Soziologie und Nationalsozialismus, Soziologie des Terrors, Fachgeschichte, Kritische TheorieAbstract
Bereits 1946 schrieb Max Horkheimer aus dem amerikanischen Exil an seinen in Deutschland verbliebenen Schüler Heinz Maus, dass er die »Ausbildung einer zeitgemässen Soziologie des Terrors« als »eine der wichtigsten und spezifisch deutschen Aufgaben« ansehe. Dieser Aufgabe ist die Soziologie bis heute nicht nachgekommen. Der Beitrag setzt an dieser Leerstelle an. Er versteht sich als eine Spurensuche, durch die Antworten auf die Frage gefunden werden sollen, warum sich ausgerechnet die Soziologie so wenig mit diesem Phänomen befasst. Der Weg, den diese Spurensuche einschlägt, ist ein Umweg. Anstatt sich unmittelbar mit der Gegenwart zu beschäftigen, fokussiert er das schwierige Verhältnis der Soziologie zum Nationalsozialismus und fragt, ob sich aus diesem etwas über die aktuelle Vernachlässigung des Rechtsterrorismus lernen lässt.
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Beiträge im Verhandlungsband des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie werden unter der Creative Commons Lizenz "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" veröffentlicht.
Dritte dürfen die Beiträge:
-
Teilen: in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
-
Bearbeiten: remixen, verändern und darauf aufbauen
unter folgenden Bedinungen:
-
Namensnennung: Dritte müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden
-
Nicht kommerziell: Dritte dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen