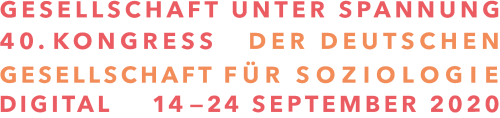Antifeminismus und Antisemitismus in der Gegenwart
Bemerkungen zu Verschränkung und kultureller Codierung
Keywords:
Antifeminismus, Antisemitismus, Extreme Rechte, Autoritäre Agitation, VerschwörungsmythenAbstract
Feminismus und ‚Gender‘ fungieren gegenwärtig über verschiedene politische Lager und Milieus hinweg als Feindbild. Insbesondere in Themenfeldern wie Familien-, Geschlechter- und Sexualpolitiken können antifeministische Gehalte eine Verbindung zwischen verschiedenen extrem rechten Strömungen und dem bürgerlichen Mainstream herstellen. Antifeminismus kommt eine wichtige ideologische wie organisatorische Integrations- und Scharnierfunktion zu. Innerhalb dieser Konstellation spielt auch (latenter) Antisemitismus eine Rolle. Nach einer Einführung in das gesellschaftsgeschichtliche und konzeptionelle Verhältnis von Antifeminismus und Antisemitismus wird im Beitrag exemplarisch analysiert, wie Antifeminismus am Beginn des 21. Jahrhunderts kulturell codiert ist und welche Potenziale der Verschränkung mit antisemitischen Deutungsmustern eröffnet werden.
References
Blum, Rebekka. 2019. Angst um die Vormachtstellung. Zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus. Hamburg: Marta Press.
Claussen, Detlev. 2005. Die Wandlungen des „Ja, aber-Antisemitismus“. Vorbemerkung zur Neuausgabe 2005. In Die Grenzen der Aufklärung. Die gesellschaftliche Genese des modernen Antisemitismus, VII–XXVI. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Fedders, Jonas. 2018. „Die Rockefellers und Rothschilds haben den Feminismus erfunden.“ Einige Anmerkungen zum Verhältnis von Antifeminismus und Antisemitismus. In Antifeminismus in Bewegung. Aktuelle Debatten um Geschlecht und sexuelle Vielfalt, Hrsg. Juliane Lang und Ulrich Peters, 213–232. Hamburg: Marta Press.
Gehmacher, Johanna. 1998. Die Eine und der Andere: Moderner Antisemitismus als Geschlechtergeschichte. In Bürgerliche Frauenbewegung und Antisemitismus, Hrsg. Mechthild Bereswill und Leonie Wagner, 101–120. Tübingen: Edition Diskord.
Hermann, Melanie. 2020. Antimoderner Abwehrkampf – zum Zusammenhang von Antifeminismus und Antisemitismus. In Wissen schafft Demokratie. Schwerpunkt Kontinuitäten, Band 7, Hrsg. Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, 26–35. Jena.
Hessel, Florian. 2020a. Elemente des Verschwörungsdenkens. Ein Essay. Psychosozial 43(1):15–26.
Hessel, Florian. 2020b. Moderne Mythen. Kurze Geschichte des Denkens in „Verschwörungen“. Forum Wissenschaft 37(4):36–39.
Hessel, Florian, und Janne Misiewicz. 2021. Antifeminismus und Antisemitismus in der Gegenwart – eine Fallanalyse zu Verschränkung und kultureller Codierung. In Wissen schafft Demokratie. Schwerpunkt Antisemitismus Bd. 8, Hrsg. Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, S. 156–167. Jena. https://www.idz-jena.de/wsddet/wsd8-15/ (Zugegriffen: 06. Aug. 2021).
Horkheimer, Max, und Theodor W. Adorno. 1987 [1947]. Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente (Gesammelte Schriften 5). Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.
Kistenmacher, Olaf. 2020. Konsequent latent. Latente Judenfeindschaft zeigt sich in verschiedenen Formen. Jungle World. https://jungle.world/artikel/2020/34/konsequent-latent (Zugegriffen: 29. Sep. 2020).
Kovács, András. 2019. Postkommunistischer Antisemitismus: alt und neu. Der Fall Ungarn. In Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, Hrsg. Christian Heilbronn, Doron Rabinovici und Natan Sznaider, 276–309. Berlin: Suhrkamp.
Lang, Juliane. 2017. „Gender“ und „Genderwahn“ – neue Feindbilder der extremen Rechten. Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/259953/gender-und-genderwahn (Zugegriffen: 20. Juli 2020).
Lang, Juliane, und Ulrich Peters. 2018. Antifeminismus in Deutschland. Einführung und Einordnung des Phänomens. In Antifeminismus in Bewegung. Aktuelle Debatten um Geschlecht und sexuelle Vielfalt, Hrsg. Juliane Lang und Ulrich Peters, 13–35. Hamburg: Marta Press.
Löwenthal, Leo, und Norbert Guterman. 1948. Portrait of the American Agitator. Public Opinion Quarterly 12(3):417–429.
O. A. 2020. Homolobby. Diskursatlas Antifeminismus. http://www.diskursatlas.de/index.php?title=Homolobby (Zugegriffen: 20. Juli 2020).
Planert, Ute. 1998. Antifeminismus im Kaiserreich. Diskurs, soziale Formation und politische Mentalität. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Scheele, Sebastian. 2016. Von Antifeminismus zu ‚Anti-Genderismus‘? Eine diskursive Verschiebung und ihre Hintergründe. Berlin: Gunda Werner Institut der Heinrich Böll Stiftung http://www.gwi-boell.de/sites/default/files/uploads/2016/08/scheele_diskursive_verschiebung_antifeminismus.pdf (Zugegriffen: 20. Juli 2020).
Schenk, Herrad. 1980. Die feministische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland. München: C.H. Beck.
Schmincke, Imke. 2015. Das Kind als Chiffre politischer Auseinandersetzung am Beispiel neuer konservativer Protestbewegungen in Frankreich und Deutschland. In Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen, Hrsg. Sabine Hark und Paula-Irene Villa, 93–108. Bielefeld: transcript.
Schwarz-Friesel, Monika. 2019. Judenhass im Internet. Antisemitismus als kulturelle Konstante und kollektives Gefühl. Leipzig/Berlin: Hentrich & Hentrich.
Volkov, Shulamit. 2000. Antisemitismus als kultureller Code. In Antisemitismus als kultureller Code. Zehn Essays, 13–36. München: C.H. Beck.
Volkov, Shulamit. 2001. Antisemitismus und Antifeminismus. Soziale Norm oder kultureller Code. In Das jüdische Projekt der Moderne. Zehn Essays, 62–81. München: C.H. Beck.
Zastrow, Volker. 2006. „Gender Mainstreaming“: Politische Geschlechtsumwandlung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/politik/gender-mainstreaming-politische-geschlechtsumwandlung-1327841.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (Zugegriffen: 24. Juni 2020).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Beiträge im Verhandlungsband des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie werden unter der Creative Commons Lizenz "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" veröffentlicht.
Dritte dürfen die Beiträge:
-
Teilen: in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
-
Bearbeiten: remixen, verändern und darauf aufbauen
unter folgenden Bedinungen:
-
Namensnennung: Dritte müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden
-
Nicht kommerziell: Dritte dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen