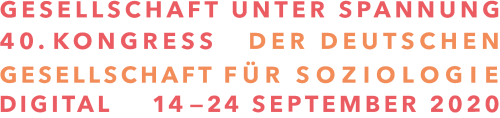Grenzen der Aufklärung?
Antisemitismusprävention unter institutionellen Bedingungen
Keywords:
Antisemitismus, Bildung, sozialwissenschaftliche Fachdidaktik, MündigkeitAbstract
Eine Auseinandersetzung mit Antisemitismen in Bildungskontexten bildet unterschiedliche Herausforderungen. Der Beitrag diskutiert strukturelle Rahmenbedingungen institutioneller Bildung und verknüpft diese mit einer exemplarischen Analyse eines Arbeitsblattes. Entscheidend ist dabei, ob sozialwissenschaftliches Wissen gegen und über Antisemitismen curricular für Lehrende und Lernende (nicht) vorgesehen ist. Exemplarisch wird skizziert, wie Bildungsmaterialien, die sowohl didaktischen als auch fachwissenschaftlichen Anforderungen genügen, keine Garantien zum Schutz vor Ressentiments bieten können. Gezeigt wird, dass neben Faktenwissen zudem sozialwissenschaftlich reflexive Wissensformen benötigt werden, um vergangene und aktuelle Erscheinungsweisen von Antisemitimen erkennen und kritisieren zu können.
References
American Jewish Committee Berlin (AJC). 2017. Salafismus und Antisemitismus an Berliner Schulen: Erfahrungsberichte aus dem Schulalltag. https://ajcberlin.org/sites/default/files/downloads/ajcstimmungsbildsalafismusantisemitismus.pdf (Zugegriffen: 28. Oktober 2019).
Bauer, Ullrich. 2020. Mit Bildung gegen das kulturelle Gedächtnis eines globalen Judenhasses – geht das? Chancen und Risiken von Prävention und Intervention. In Bildung gegen Antisemitismus. Spannungsfelder der Aufklärung, Hrsg. Marc Grimm und Stefan Müller, 21–43. Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag.
Bernstein, Julia. 2018. „Mach mal keine Judenaktion!“ Herausforderungen und Lösungsansätze in der professionellen Bildungs- und Sozialarbeit gegen Antisemitismus. https://www.frankfurt-university.de/antisemitismus-2017 (Zugegriffen: 15. April 2019).
Bernstein, Julia. 2020. Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Befunde – Analysen – Handlungsoptionen. Weinheim u.a.: Beltz-Juventa.
Bernstein, Julia, Marc Grimm und Stefan Müller, Hrsg. 2021. Schule als Spiegel der Gesellschaft. Antisemitismen erkennen und handeln. Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag.
Brumlik, Micha. 2016. Pädagogische Reaktionen auf Antisemitismus. In Strategien der extremen Rechten. Hintergründe – Analysen – Antworten, 2. Aufl., Hrsg. Stephan Braun, Alexander Geisler und Martin Gerster, 639–650. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Bundeszentrale für politische Bildung (BpB). 2020. Themenblätter im Unterricht Nr. 123: Antisemitismus. https://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/315213/antisemitismus (Zugegriffen: 28. Dezember 2020).
Grimm, Marc und Stefan Müller, Hrsg. 2020. Bildung gegen Antisemitismus. Spannungsfelder der Aufklärung. Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag.
Horkheimer, Max und Theodor W. Adorno. 2003 [1947]. Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Limitierte Sonderausgabe. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
KMK/Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten/Zentralrat der Juden in Deutschland. 2021. Gemeinsame Empfehlung des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten und der Kulturministerkonferenz zum Umgang mit Antisemitismus in der Schule. https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2021/2021_06_10-Gem-Empfehlung-Antisemitismus.pdf (Zugegriffen: 30. August 2021).
Mendel, Meron. 2020. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Herausforderungen antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ): Antisemitismus 70:36–41.
Messerschmidt, Astrid. 2014. Bildungsarbeit in der Auseinandersetzung mit gegenwärtigem Antisemitismus. Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 64:38–44.
Müller, Stefan. 2020a. Reflexivität in der politischen Bildung. Untersuchungen zur sozialwissenschaftlichen Fachdidaktik. Frankfurt am Main: Wochenschau Verlag.
Müller, Stefan. 2020b. Das Versprechen vom Bessermachen. Reflexion und Kritik im Kontext institutioneller Bildung. https://www.itdb.ch/index.php/itdb/article/view/24/32 (Zugegriffen: 28. Dezember 2020).
Müller, Stefan. 2021. Identität und antisemitische Ressentiments in Bildungskontexten. Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften 12(1):36–54.
Nirenberg, David. 2015. Anti-Judaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens. München: Verlag C.H. Beck.
OSCE und Yad Vashem. 2007. Antisemitismus thematisieren: Warum und wie? Leitfaden für Pädagoginnen und Pädagogen. https://www.osce.org/de/odihr/29892?download=true (Zugegriffen: 28. Oktober 2019).
Salzborn, Samuel und Alexandra Kurth. 2019. Antisemitismus in der Schule. Erkenntnisstand und Handlungsperspektiven. https://www.tu-berlin.de/fileadmin/i65/Dokumente/Antisemitismus-Schule.pdf (Zugegriffen: 28. Dezember 2020).
Scherr, Albert. 2013. Ausgangsbedingungen und Perspektiven der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Der Bürger im Staat 63:270–277.
Scherr, Albert und Barbara Schäuble. 2006. „Ich habe nichts gegen Juden, aber …“. Ausgangsbedingungen und Ansatzpunkte gesellschaftspolitischer Bildungsarbeit zur Auseinandersetzung mit Antisemitismen. Langfassung Abschlussbericht. https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/schaueblescherrichhabenichtslangversion.pdf (Zugegriffen: 28. Dezember 2020).
Schwarz-Friesel, Monika. 2019. Judenhass 2.0: Das Chamäleon Antisemitismus im digitalen Zeitalter. In Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte, 2., erweiterte und überarbeitete Auflage, Hrsg. Christian Heilbronn, Doron Rabinovici und Natan Sznaider, 385–417. Berlin: Suhrkamp.
Unabhängiger Expertenkreis Antisemitismus. 2017. Antisemitismus in Deutschland – aktuelle Entwicklungen. Zweiter Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/gesellschaft-integration/expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.html (Zugegriffen: 28. Dezember 2020).
Zentralrat der Juden in Deutschland, Hrsg. 2020. „Du Jude“. Antisemitismus-Studien und ihre pädagogischen Konsequenzen. Leipzig: Hentrich & Hentrich.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Beiträge im Verhandlungsband des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie werden unter der Creative Commons Lizenz "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" veröffentlicht.
Dritte dürfen die Beiträge:
-
Teilen: in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
-
Bearbeiten: remixen, verändern und darauf aufbauen
unter folgenden Bedinungen:
-
Namensnennung: Dritte müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden
-
Nicht kommerziell: Dritte dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen