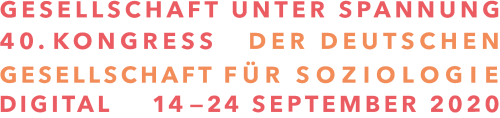Das umstrittene Erbe von 1989
Gesellschaftliche Aneignungen, Umdeutungen, Erinnerungspolitiken
Schlagwörter:
Kultursoziologie, ErinnerungspolitikAbstract
Der Beitrag problematisiert die bisherige soziologische Debatten zu 1989 aus einer dezidiert kultursoziologischen Perspektive. Herausgearbeitet wird der Charakter von 1989 als ebenso charismatischer wie umstrittener „Erinnerungsort“ (Nora). Dieser Erinnerungsort war von Anfang an ambivalent und umstritten. Ambivalent, weil sich ab dem Herbst 1989 sehr komplexe Entwicklungen überlagert haben und eigendynamisch ineinanderschoben. Dafür spricht die angesprochene Vielfalt der Bezeichnungen, die aus dieser Zeit stammen, und ganz verschiedene Perspektiven und Betroffenheiten sowie Affekte offenbaren, die sich mit diesem Ereignis verbinden. Umstritten ist er, weil sich an ihm früh kollektive Gedächtnisse gespalten und diversifiziert haben, und dies weiterhin tun – bis zum gegenseitigen Unverständnis oder gar Bruch zwischen damals Beteiligten. Der Beitrag plädiert vor diesem Hintergrund für eine verstärkte Hinwendung zu den eigensinnigen Narrativen, die von den verschiedenen Akteuren ins Spiel gebracht werden, aber auch für eine stärkere Selbstreflektion der deutenden Sozialwissenschaften.
Literaturhinweise
Bude, Heinz. 2011. Ein natürliches Experiment. In Am Beispiel Wittenberge: Ansichten einer fragmentierten Gesellschaft, Hrsg. Heinz Bude, Thomas Medicus und Andreas Willisch, 13–21. Hamburg: Hamburger Edition.
Bergem, Wolfgang. 2014. Narrative Formen in Geschichtspolitik und Erinnerungskultur. In Narrative Formen der Politik, Hrsg. Wilhelm Hofmann, Judith Renner und Katja Teich, 31–48. Wiesbaden: Springer VS.
Dietz, Helga. 2015. Prozesse erzählen – oder was die Soziologie von der Erzähltheorie lernen kann. In Prozesse. Formen, Dynamiken, Erklärungen, Hrsg. Rainer Schützeichel und Stefan Jordan, 321–335. Wiesbaden: Springer VS.
Fischer, Joachim. 2010. Bürgerliche Gesellschaft. Zur analytischen Kraft der Gesellschaftstheorie. In Bürgerlichkeit ohne Bürgertum. In welchem Land leben wir? Hrsg. Heinz Bude, Joachim Fischer und Bernd Kauffmann, 203–227. München: Fink.
Geißler, Rainer. 2000. Nachholende Modernisierung mit Widersprüchen. Eine Vereinigungsbilanz aus modernisierungstheoretischer Perspektive. In Vom Zusammenwachsen einer Gesellschaft: Analysen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland, Hrsg. Heinz-Herbert Noll und Roland Habich, 37–62. Frankfurt am Main/New York: Campus.
Großbölting, Thomas. 2020. Wem gehört die Friedliche Revolution? Die Pollack-Kowalczuk-Kontroverse von 2019 als Lehrstück von Wissenschaftskommunikation. Deutschland Archiv, 14.07.2020, Link: www.bpb.de/312786
Haese, Inga. 2012. Von Therapeuten, Chirurgen und Wutsorgern der Stadt. Der Stoff, aus dem Charisma ist. In Wittenberge ist überall. Überleben in schrumpfenden Regionen, Hrsg. Andreas Willisch, 61–93. Berlin: Ch. Links.
Hartmann, Greta und Alexander Leistner. 2019. Umkämpftes Erbe. Zur Aktualität von „1989“ als Widerstandserzählung. Aus Politik und Zeitgeschichte (Themenheft „Das letzte Jahr der DDR“), Band 35–37: 18–24.
Jahoda, Marie, Paul F. Lazarsfeld, und Hans Zeisel. 1994 [1933]. Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Karstein, Uta und Monika Wohlrab-Sahr. 2021. Culture. Soziologie – Sociology in the German-speaking world. Sonderheft der Soziologischen Revue: 9–26. https://doi.org/10.1515/9783110627275-002 (im Druck).
Klinge, Sebastian. 2015. 1989 und wir. Geschichtspolitik und Erinnerungskultur nach dem Mauerfall. Bielefeld: transcript.
Kollmorgen, Raj. 2011. Zwischen nachholender Modernisierung und ostdeutschem Avantgardismus. Ostdeutschland und deutsche Einheit im Diskurs der Sozialwissenschaften. In Diskurse der deutschen Einheit. Kritik und Alternativen, Hrsg. Raj Kollmorgen, Frank Thomas Koch und Hans Luidger Dienel, 27–66. Wiesbaden: VS Verlag.
Kollmorgen, Raj. 2019. ,Exit West‘. Fünf Thesen zur Geschichte der (ost-)deutschen Transformationsforschung. Zeitgeschichte Online, URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/exit-west.
Koselleck, Rainer. 1979: ‚Erfahrungsraum‘ und ‚Erwartungshorizont‘ – zwei historische Kategorien. In Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Rainer Koselleck, 349–374. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kowalczuk, Ilko-Sascha. 2015: Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR. München: C.H. Beck.
Leistner, Alexander und Julia Böcker. 2021. „Im Osten geht die Sonne auf“ – Nostalgie als soziologische Erklärung der Gegenwart von Vergangenheit in Ostdeutschland? Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History (im Erscheinen).
Leistner, Alexander und Anna Lux. 2021. Von der Uneindeutigkeit des Widerstands. Um- und Neudeutungen der „Friedlichen Revolution“ seit 1989. In Die revolutionären Umbrüche in Europa 1989/91: Deutungen und Repräsentationen, Hrsg. Jörg Ganzenmüller. Köln/Weimar/Wien: Böhlau (im Erscheinen).
Lux, Anna und Alexander Leistner. 2021. „Letztes Jahr Titanic“. Untergegangene Zukünfte in der ostdeutschen Zusammenbruchsgesellschaft seit 1989/90. Historische Anthropologie (im Erscheinen).
Mau, Steffen. 2019. Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Berlin: Suhrkamp.
Meulemann, Heiner. 1995. Aufholtendenzen und Systemeffekte. Eine Übersicht über Wertunterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Aus Politik und Zeitgeschichte 40:21–33.
Nora, Pierre. (Hrsg.) 2005. Erinnerungsorte Frankreichs. München: C.H. Beck.
Opp, Karl-Dieter, Peter Voß und Christiane Gern. 1993. Die volkseigene Revolution. Stuttgart: Klett.
Pollack, Detlef. 1996. Sozialstruktureller Wandel, Institutionentransfer und die Langsamkeit der Individuen. Untersuchungen zum ostdeutschen Transformationsprozess in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, der Zeitschrift für Soziologie und der Sozialen Welt. Soziologische Revue 19:412–429.
Pollack, Detlef. 2020. Das unzufriedene Volk. Protest und Ressentiment in Ostdeutschland von der friedlichen Revolution bis heute. Bielefeld: transcript.
Reißig, Rolf. 1998. Transformationsforschung: Gewinne, Desiderate und Perspektiven. Politische Vierteljahresschrift 39(2):301–328.
Rüth, Axel. 2012. Narrativität in der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung. In Narrativität als Begriff. Analysen und Anwendungsbeispiele zwischen philologischer und anthropologischer Orientierung, Hrsg. M. Aumüller, 21–46. Berlin: de Gruyter.
Sabrow, Martin. 2009. Die DDR erinnern. In Erinnerungsorte der DDR. Hrsg. Martin Sabrow, 11–27. München: C.H. Beck.
Sabrow, Martin. 2019. Mythos 1989. Rückblick auf ein historisches Jahr. Wem gehört die friedliche Revolution? URL: www.bpb.de/300737
Sewell, William H. Jr. 2005. Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago: University of Chicago Press.
Skocpol, Theda. 1979. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge: Cambridge UP.
Stach, Sabine und Greta Hartmann. 2020. Friedliche Revolution 2.0? Zur performativen Aneignung von 1989 durch „Querdenken“ am 7. November 2020 in Leipzig. Zeitgeschichte-online, URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/friedliche-revolution-20.
Steil, Armin. 2021. „Es war DDR live“ – Zum Phänomen der retrospektiven Identifikation im Kontext des Nationalpopulismus. In Erbe 89 – Politisierung der Erinnerung. Deutungsversuche und Erklärungsansätze, Hrsg. Alexander Leistner und Monika Wohlrab-Sahr. (im Erscheinen).
Viveiros de Castro, Eduardo. 2019. Kannibalische Metaphysiken. Elemente einer post-strukturalen Anthropologie. Leipzig: Merve.
White, Hayden. 1973. Meta history. The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Beiträge im Verhandlungsband des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie werden unter der Creative Commons Lizenz "Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" veröffentlicht.
Dritte dürfen die Beiträge:
-
Teilen: in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
-
Bearbeiten: remixen, verändern und darauf aufbauen
unter folgenden Bedinungen:
-
Namensnennung: Dritte müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden
-
Nicht kommerziell: Dritte dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen