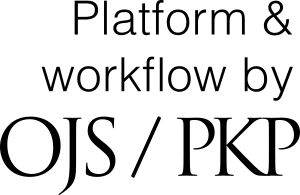Editorial
Abstract
»Ich habe einen Anschlag auf Sie vor ....« Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Telefonate, die so beginnen, enden in aller Regel damit, dass man sich dazu verpflichtet hat, einen Antrag auf ein Promotionsstipendium zu begutachten, ein externes Dissertationsgutachten zu verfassen, an einem Habilitationsverfahren teilzunehmen, externes Mitglied einer Berufungskommission zu werden, ein Gutachten in einem Berufungsverfahren zu verfassen, ein vergleichendes Gutachten in einem Berufungsverfahren zu verfassen, einen Projektantrag zu begutachten, einen Sonderforschungsbereich zu begehen, an einer Akkreditierung mitzuwirken (Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Manche dieser Verpflichtungen haben ihren guten Sinn, andere nimmt man auf sich, obwohl viel dagegen spricht. [1]
Warum tut man das? Tatsächlich gibt es gute Gründe, Aufgaben im Rahmen von Begutachtungsverfahren zu übernehmen. Wissenschaftliche Personal- und Projektentscheidungen sind Entscheidungen unter hoher Unsicherheit. Das liegt daran, dass sie prinzipiell auf die Entstehung von etwas Neuem angelegt sind; dass also ihre Qualität darin besteht, dass man nicht weiß, was dabei rauskommt. Darum lässt sich innovative Wissenschaft nicht an konkreten Bedarfen ausrichten, auf welche die Forschung zweckrational eingestellt werden könnte. Aus diesem Grund bleiben für Entscheidungen über die Qualität wissenschaftlicher Vorhaben letztlich nur wissenschaftsimmanente Kriterien.
Die Konsequenz davon ist, dass Qualitätssicherung im Wissenschaftssystem nur als kollektive Selbstkontrolle funktionieren kann. Selbstkontrolle im Wissenschaftssystem ist keineswegs neu. Allerdings ist mit der Professionalisierung und der zunehmenden Institutionalisierung der Forschung in
den letzten einhundert Jahren eine zunehmende Formalisierung der Selbstkontrolle einher gegangen. Zum (wissenschafts-)öffentlichen Austausch von Argumenten als Grundform kollektiver Selbstkontrolle kamen zunehmend formalisierte Verfahren hinzu. Diese Verfahren wurden institutionalisiert und entwickelten dadurch ein gewisses Eigenleben, waren aber in ihrer Anzahl und Komplexität überschaubar. Ersteres sicherte die Relevanz ihrer Ergebnisse, letzteres deren Berechenbarkeit. Das funktionierte zwar nicht immer gut, aber es funktionierte mit vertretbarem Zeitaufwand.
In den vergangenen zehn Jahren hat sich daran etwas Entscheidendes geändert: Das akademische System geriet unter zunehmenden Außendruck. Dieser Druck führte zur zunehmenden Überlastung bestehender Institutionen der Selbstkontrolle und zur Entwicklung neuer Kontrollinstitutionen. Diese Institutionen haben eine komplizierte Aufgabe zu lösen: Sie sind einerseits auf wissenschaftsexterne Steuerung angelegt, kommen aber andererseits ohne wissenschaftsinterne Expertise nicht aus. Die Lösung dieser komplizierten Aufgabe gelingt durch die Ausbildung einer paradoxen Form wissenschaftspolitischer Steuerung: durch fremdgesteuerte Selbstkontrolle. Das funktioniert, solange der wissenschaftliche Sachverstand dabei mitmacht.
Ihr
Georg Vobruba
[1] Vgl. dazu Heinz Steinert. Zur Professionalität des Gutachtens. Eine Aufforderung, vergleichende Gutachten zu verweigern. Soziologie, 33. Jg., Heft 4/ 2004, 36-43.