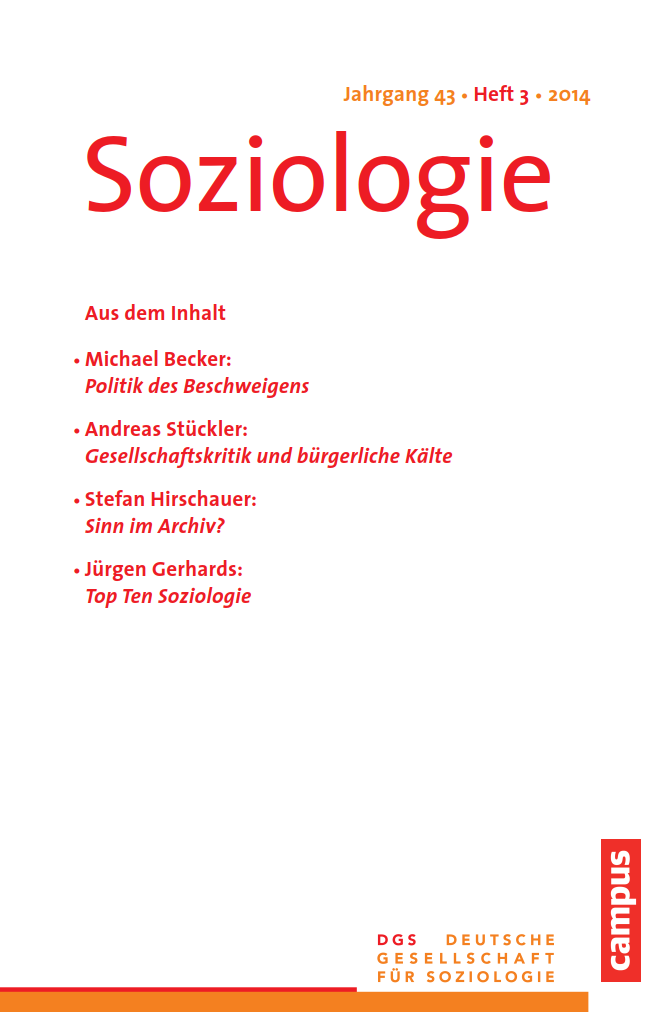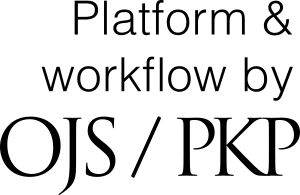Editorial
Schlagworte:
BolognaAbstract
Gewöhnung,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ist ein soziologisch hoch relevanter, sozialer Prozess. Zu dieser Einsicht führt ein Umkehrschluss. »Die Erzeugung neuer Bedürfnisse ist die erste geschichtliche Tat.« Wenn Marx und Engels damit Recht haben, dann ist Gewöhnung eine elementare soziale Voraussetzung für Stillstand. Zwei Beispiele:
Die offizielle Arbeitslosenquote in der Bunderepublik in diesem Mai beträgt 6,6%. Vor ein paar Jahrzehnten hat man viel niedrigere Arbeitslosigkeit als Indiz einer tiefen Krise des Kapitalismus angesehen und daran weit reichende Folgerungen für Systemwandel geknüpft. Das ist lange her.
Gegenwärtig werden Arbeitslosenzahlen unter drei Millionen als Erfolg zur Kenntnis genommen. Sowohl im internationalen Vergleich als auch im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren sieht die Lage ja tatsächlich relativ günstig aus. Man hatte sich schon an viel höhere Arbeitslosenzahlen gewöhnt. Und die relevanten Akteure haben längst gelernt: Arbeitslosigkeit schadet zwar den Arbeitslosen, aber man kann mit Millionen Arbeitslosen durchaus Wahlen gewinnen.
Das zweite Beispiel ist der Bologna-Prozess, der 1999 begann. Die Erklärung der Bildungsminister aus 29 europäischen Ländern, der später noch viele weitere beitraten, führte zu einem Reformprozess, in dem über mehrere Umsetzungsschritte atemberaubend unsinnige Resultate erzielt wurden. Verlängerung statt Verkürzung der Studiendauer (dazu kommt noch die zögerliche Rückkehr von G8 zu G9), keine Steigerung der Studierendenmobilität, Überregulierung, Verschulung, Stressverstärkung. Darauf heute noch im Detail einzugehen, erübrigt sich. Es findet sich kaum noch eine Politikerin, kaum ein Universitätsfunktionär, der seine Pflichtkritik am Bologna-Prozess nicht öffentlich abgeliefert hätte. Man habe es ja nur gut gemeint, die nachgeordneten Instanzen hätten die ursprünglichen Absichten aber grob verfälscht. Übel kann einem werden, wenn man von ehemaligen Bologna-Antreiber hört, sie hätten immer schon gesagt haben, dass das nichts werden kann.
Mittlerweile ist zweierlei passiert. Zum einen wurden die Reformen reformiert. Manche der schlimmsten Ungereimtheiten wurden beseitigt, einige Folgen abgemildert, teils durch abermalige Änderungen der Studien- und Prüfungsordnungen und teils informell. Und zum anderen finden Gewöhnungsprozessse an die Bologna-Reform statt. Dazu tragen mehrere Faktoren bei. Erstens arbeitet und lebt es sich schlecht unter Bedingungen, die man rundum ablehnt. Also arrangiert man sich mit ihnen und trickst. Zweitens entwickelte sich eine bizarre, aber nicht wirkungslose Legitimationsfigur: Früher war ja auch nicht alles ideal.
Das hat zwar nie jemand behauptet, aber es legt die Vorstellung nahe, dass die Älteren frühere Verhältnisse verklären oder aber ehemaligen Privilegien nachtrauern. Und dies führt unmittelbar zum dritten Punkt, der kollektiven Gewöhnung durch den Generationeneffekt. Studierende und Lehrende haben zwar starkes Unbehagen an der gegenwärtigen Situation der Universitäten, aber ohne die konkrete Verschlechterungserfahrung ist es schwierig, dieses Unbehagen zu artikulieren. Der Anteil an Universitätsangehörigen mit Vor-Bologna-Erfahrung nimmt von Jahr zu Jahr ab. Vergleiche mit der Situation vor Bologna werden mehr und mehr zur Domäne der schrumpfenden Gruppe der Älteren. Alle drei Faktoren führen zu Gewöhnung, die Gewöhnung durch den Generationeneffekt wirkt wohl am stärksten. Soziologisch bezeichnet Gewöhnung den Prozess der Entwicklung von Deckungsgleichheit zwischen Erwartungen an und Leistungsfähigkeit von Institutionen. Man kann Gewöhnung also möglicherweise als Ergänzung der Hirschmanschen Trias von Abwanderung, Widerspruch und Loyalität auffassen.
»Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse.« Auch dieser Satz ist von Marx und Engels aus der »Deutschen Ideologie«. Er behauptet nicht das Gegenteil des ersten Zitats, sondern weist auf einen Prozess wechselseitiger Verstärkung. Früher nannte man das Dialektik. Bedürfnisse treiben die Entwicklung der Mittel zu ihrer Befriedigung an, und dies erzeugt neue Bedürfnisse. In den letzten Jahrzehnten fand das Gegenteil statt. Man hat sich an abgesenkte politische Leistungsniveaus gewöhnt und reduzierte Erwartungen als Gewohnheiten stabilisiert, welche weitere gewöhnungsbedürftige Leistungsabsenkungen ermöglichen.
Ihr
Georg Vobruba