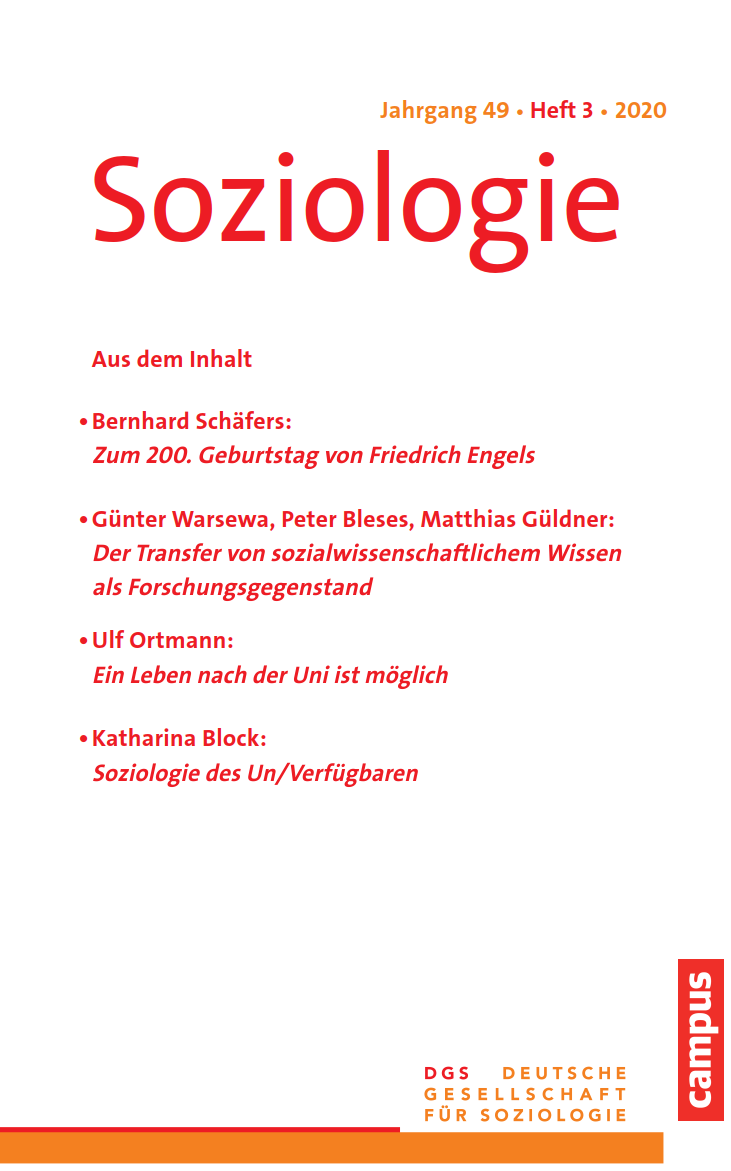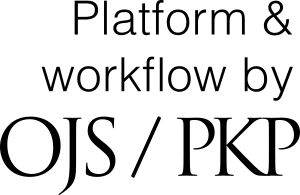Editorial
Abstract
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
»Civil inattention« nannte Erving Goffman eine soziale Kunstfertigkeit, in der es insbesondere die Bewohner dicht bevölkerter Großstädte unweigerlich zu einiger Kennerschaft bringen, wenn sie sich regelmäßig in öffentlichen Räumen bewegen. Ein unendlich feines Reservoir von Gesten, Blicken, Requisiten wird genutzt, um den anderen unbekannten Anwesenden zu signalisieren, dass man selbst bei größter körperlicher Nähe die Grenzen des Gegenübers kennt und keine Bedrohung empfindet oder selbst darstellt. Der Blick auf die eigenen Schuhspitzen im überfüllten Bus, das Offenhalten der Kaufhaustür für den nächsten Passanten, die vertiefte Lektüre im Bahnabteil, obwohl bei den Mitreisenden gegenüber gerade ein Familienstreit Fahrt aufnimmt – all diese kleinen, eingespielten Routinen haben wir in den vergangenen Wochen in atemberaubender Geschwindigkeit verlernt, vielleicht müsste man sagen: uns abtrainiert. Wo man überhaupt noch mit größeren Gruppen unbekannter Menschen einen Raum teilt, ist man nun im Gegenteil darauf bedacht, Aufmerksamkeit für das Einhalten von physischen Abständen zu zeigen und nicht sozial zu demonstrieren. Dass der eigene und der andere Körper nun gänzlich ungewollt zu Unsicherheitsfaktoren in einem infektiösen Geschehen werden, führt zu einer Ersetzung der routinisierten Gesten durch solche, die zuvor vielleicht als Ablehnung verstanden worden wären – und nun Ausdruck von »civil attention« für mein Gegenüber sind: das Zurückweichen, wenn man im Supermarkt gleichzeitig denselben engen Gang ansteuert; das kurze Wegdrehen des Kopfes und Anhalten des Atems wenn man doch zu nah aneinander vorbeiläuft und der schnelle Schritt nach hinten, wenn einem im kurzen Gespräch auf der Straße der Abstand zu klein erscheint.
Wie schnell und umfassend sich seit März alltägliche Gewohnheiten, soziale Routinen und Normalitätsverständnisse ändern und anpassen mussten, konnte einen alltagsweltlich mal ängstigen, mal amüsieren und soziologisch mindestens in Staunen versetzen. Die Binse, dass man soziologisch immer etwas beobachtet, dessen Teil man zugleich ist, konnte in den vergangenen Wochen jeder erleben, der es sich nicht gleich wieder in hergebrachten Deutungsmustern gemütlich machen wollte. Dass dieses Verstricktsein in den eigenen Gegenstand aktuell auch forschungspraktisch ganz eigene Probleme aufwirft, nimmt Jo Reichertz in diesem Heft zum Anlass, zur gemeinsamen Diskussion auf dem SozBlog aufzurufen: Insbesondere im Bereich der qualitativen Forschung sind aktuell geplante Projekte und Qualifizierungsarbeiten vor große Herausforderungen gestellt. Was bleibt von der teilnehmenden Beobachtung in Zeiten sozialer Distanzierung? Welche Risiken darf, kann oder sollte man eingehen, wenn Feldaufenthalte anstehen? Wie reagieren Organisationen, Institutionen, Teams auf die neuen Bedingungen? Diese und weitere Fragen stehen auf dem SozBlog zur gemeinsamen Diskussion, die Lektüre lohnt ebenso wie die eigene Beteiligung. Zumindest für den diesjährigen Kongress stellen sich viele der genannten Herausforderungen nicht und werden durch andere ersetzt: Wir sehen uns im September nicht in Berlin, sondern auf unseren Bildschirmen. Die Entscheidung, den gesamten Kongress digital stattfinden zu lassen, ist nicht leichtgefallen – ermöglicht aber hoffentlich vielen von Ihnen eine unbesorgte Teilnahme. Und auch wenn viele der informellen Pausengespräche und Kaffeeverabredungen dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden können, finden sich sicher andere lohnende Formen des gemeinsamen fachlichen Austauschs.
Herzlich, Ihre
Sina Farzin