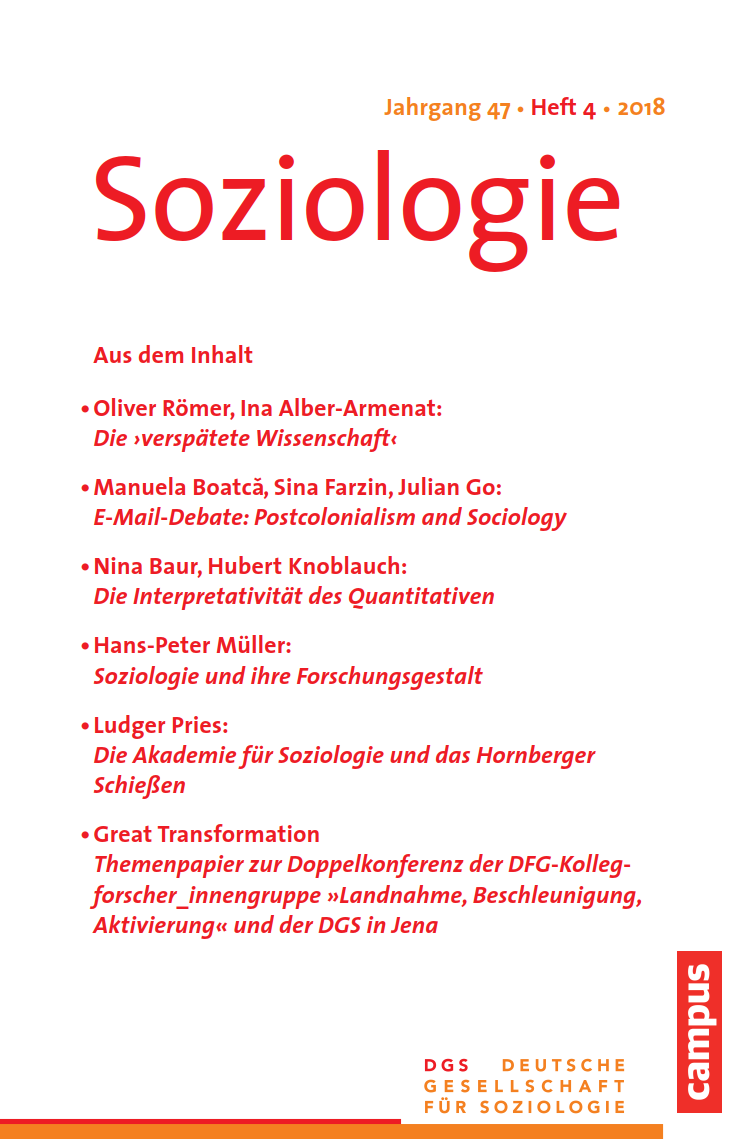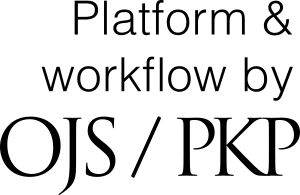Editorial
Abstract
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Im SPIEGEL Nr. 34/2018 lernte ich unlängst über den Spitzenkandidaten der hessischen SPD Thorsten Schäfer-Gümbel, dass er die Probleme der »sogenannten kleinen Leute« auf Soziologendeutsch beschreibt. Das könnte eine gute Nachricht sein, legt sie doch nahe, dass Herr Gümbel empirisch begründete Vorstellungen von der Beschaffenheit dieser Probleme und trennschärfere Begriffe als den der »kleinen Leute« zur Verfügung hat, um den inhaltlichen Herausforderungen zu begegnen, die politische Spitzenämter mit sich bringen.
Es war aber wohl anders gemeint. Die beiden Autoren des Portraits sahen gerade in diesem Soziologendeutsch ein eher bedauernswertes Problem des Kandidaten, das – gänzlich unabhängig vom konkreten Fall – ein Ärgernis für die Soziologie sein könnte.
Denn, so entnehme ich der einzigen zitierfähigen Definition, die ich finden konnte: Soziologendeutsch ist »Jargon, oft kombiniert mit Bandwurmsätzen und Hauptwörterei, vertuscht die Plattheit eines Arguments, verhindert, dass man dieses überhaupt versteht, lähmt so die mögliche Kritik und verspricht zugleich eine geistige Tiefe, die nicht vorhanden ist.«
Keine Auskunft gibt der Text zu der Frage, warum ausgerechnet der Soziologie die Ehre zuteilwurde, Namensgeberin für ein derart scharfes rhetorisches Schwert zu sein. Der Vorwurf, einen »Jargon« zu pflegen, traf ja zunächst vor allem das philosophische Schreiben und wurde im »Jargon der Eigentlichkeit« von Theodor W. Adorno zu einer umfassenden ideologie- und sprachkritischen Auseinandersetzung verdichtet. Noch weniger einleuchten will mir die Schlussfolgerung, andere Disziplinen, denken wir an die Physik oder die Medizin, kämen mit weniger Substantivierungen zur Erfassung und Beschreibung ihrer Gegenstände aus. Oder per se mit weniger Kommata. Anders als im Fall der Soziologie scheint man hier aber gewillt zu sein, die für Nicht-Eingeweihte ebenfalls kaum verständliche Fachsprache als notwendiges, weil exakteres Ausdrucksmittel hinzunehmen. Das alles soll nicht heißen, dass in einigen soziologischen Texten nicht manchmal einfacher oder klarer formuliert werden könnte – aber auch das halte ich nicht für ein Alleinstellungsmerkmal soziologischen, sondern letztendlich jeglichen wissenschaftlichen Schreibens. Das Soziologendeutsch zumindest, das ich kenne und schätze, gewinnt ja grade aus der Differenz zur Alltagssprache seine begriffliche Klarheit – nicht nur aber eben auch bei der Thematisierung vorgeblich alltäglicher Phänomene. Nun ja, ich fürchte, die wenig schmeichelhafte Fremdzuschreibung werden wir als Disziplin nicht so schnell wieder los. Da hilft im Zweifelsfall nur Selbstaufklärung: Beiträge zur Semantik oder Begriffsgeschichte des unerfreulichen Terminus nehmen wir gerne für unsere Rubrik »Soziologie in der Öffentlichkeit« entgegen.
Und wer sein aktives Soziologendeutsch im besten Sinne intensiv pflegen möchte, ist sicher Ende September in Göttingen auf dem DGS Kongress am richtigen Ort. Zur Einstimmung finden Sie im vorliegenden Heft einen Beitrag zur Geschichte der Soziologie in Göttingen von Ina Alber-Armenat und Oliver Römer. Vielleicht sehen wir uns dann ja dort auf ein paar Sätze SoziologInnendeutsch? Das wäre schön!
Herzlich, Ihre
Sina Farzin