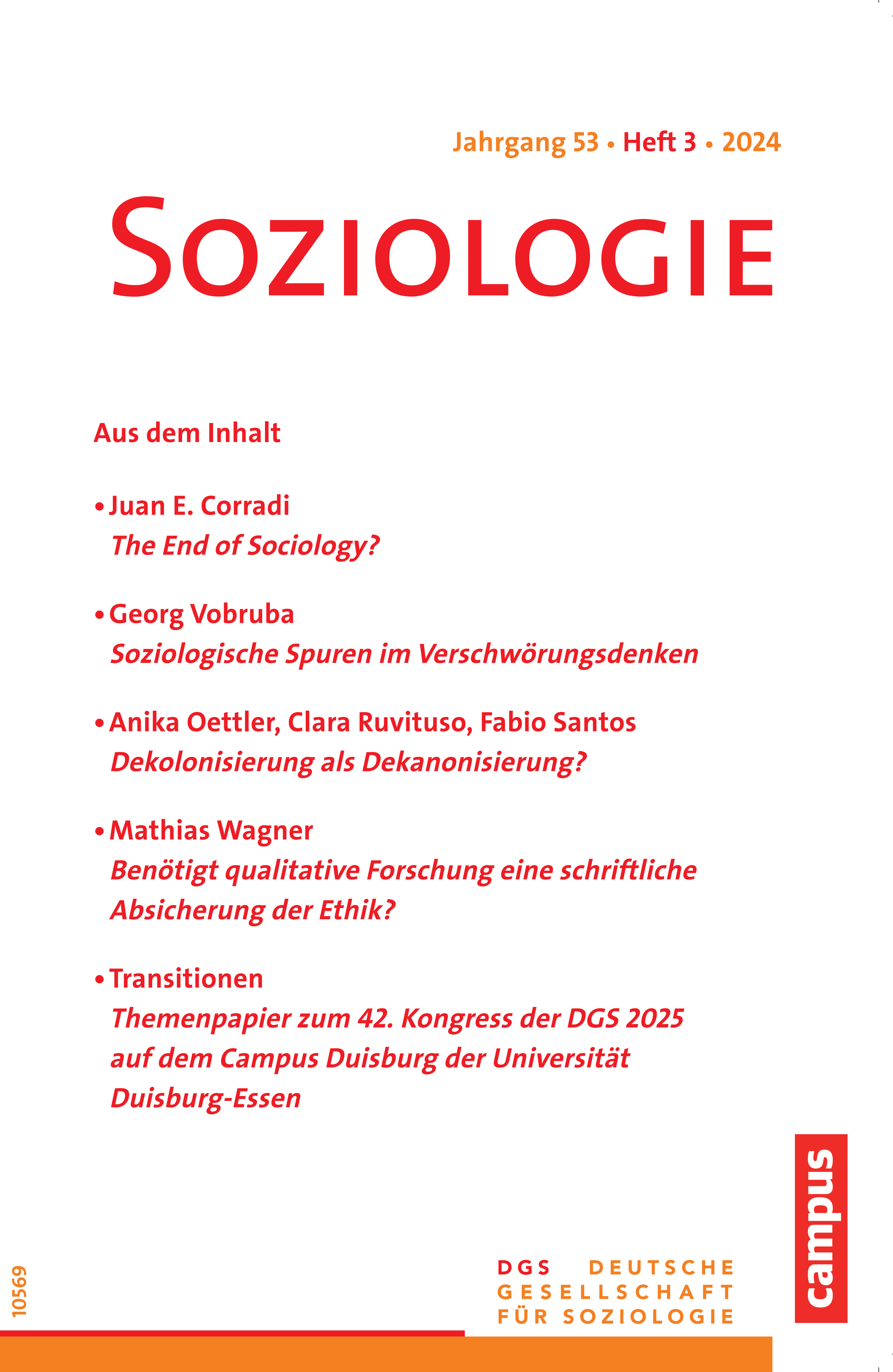Benötigt qualitative Forschung eine schriftliche Absicherung der Ethik?
Schlagwörter:
Interview, Anonymisierung, Qualitative SozialforschungAbstract
In der qualitativen Sozialforschung wird heute die schriftliche Zustimmung der Interviewpartnerinnen und -partner zu Interviews gefordert. Bis vor wenigen Jahren reichte dagegen noch die Selbstverpflichtung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Anonymisierung der Daten und zum Persönlichkeitsschutz der Akteure aus. Es wird die Frage aufgeworfen, ob mit der Veränderung zur schriftlichen Form tendenziell bestimmte soziale Gruppen die Teilnahme an Forschungen aus Misstrauen verweigern. Trifft das zu, so wird der Zugang zu vulnerablen sozialen Schichten oder zu Personen mit Misstrauen gegenüber der etablierten Gesellschaft unmöglich. Zudem widerspricht die schriftliche Zustimmung zu einem Interview der Alltagslogik von Vertrauen in der Kommunikation. Gerade in ethnografischen Forschungen gewähren Akteure aufgrund von nicht formalen Kriterien Einblick in ihren Alltag.
In qualitative social research today, the written consent of interviewees is required for interviews. Until a few years ago, however, the self-commitment of the researchers to anonymize the data and to protect the privacy of the participants was sufficient. The question is raised as to whether the change to the written form means that certain social groups tend to refuse to participate in research out of mistrust. If this is the case, access to vulnerable social groups or people with a mistrust of established society becomes impossible. In addition, written consent to an interview contradicts the everyday logic of trust in communication. In ethnographic research in particular, actors provide insight into their everyday lives on the basis of non-formal criteria.
Literaturhinweise
Bourdieu, Pierre 2005: Verstehen. In Pierre Bourdieu et al., Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz: Universitätsverlag, 393–426.
Dean, John P. 1954: Participant Observation and Interviewing. In John Th. Doby (ed.), An Introduction to Social Research. Harrisburg: Stackpole Co., 225–252.
Girtler, Roland 1996: Randkulturen. Theorie der Unanständigkeit. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.
Girtler, Roland 2001: Methoden der Feldforschung. Wien, Köln, Weimar: Böhlau.
Gläser, Jochen 1999: Datenschutzrechtliche und ethische Probleme beim Publizieren von Fallstudien: Informantenschutz und ›Objektschutz‹. SOZIOLOGIE, 28. Jg., Heft 4, 32–47.
Heiland, Hans-Günther / Lüdemann, Christian 1993: Ein untauglicher Versuch soziologischer Moralbildung? Kritische Anmerkungen zum Ethik-Kodex. SOZIOLOGIE, 22. Jg., Heft 2, 97–110.
Hopf, Christel 1991: Zwischen Betrug und Wahrhaftigkeit – Fragen der Forschungsethik in der Soziologie. SOZIOLOGIE, 20. Jg., Heft 2, 174–191.
Luhmann, Niklas 2000: Vertrauen. Ein Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart: Lucius und Lucius.
Reichertz, Jo 2021: Die coronabedingte Krise der qualitativen Sozialforschung. SOZIOLOGIE, 50. Jg., Heft 3, 313–335.
Sennett, Richard 2005: Die Kultur des Neuen Kapitalismus. Berlin: Berlin Verlag.
Simmel, Georg 1992: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Venkatesh, Sudhir 2008: Underground Economy. Was Gangs und Unternehmen gemeinsam haben. Berlin: Ullstein.
von Unger, Hella 2014: Forschungsethik in der qualitativen Forschung: Grundsätze, Debatten und offene Fragen. In Hella von Unger / Petra Narimani / Rosaline M’Bayo (Hg.), Forschungsethik in der qualitativen Forschung. Reflexivität, Perspektiven, Positionen. Wiesbaden: Springer, 15–39.
Wagner, Mathias 2011: Die Schmugglergesellschaft. Informelle Ökonomien an der Ostgrenze der Europäischen Union: Eine Ethnographie. Bielefeld: Transcript.
Wagner, Mathias 2013: »Meist merkt man, dass etwas geschehen ist« – die Kinder der Wanderarbeiter. In Mathias Wagner / Kamila Fiłkowska / Mara Piechowska / Wojciech Łukowski (Hg.), Deutsches Waschpulver und polnische Wirtschaft. Bielefeld: transcript, 183–207.