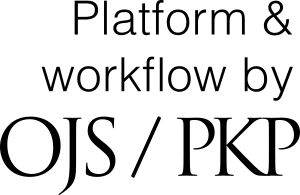Editorial
Schlagworte:
Metakrise, Sichtbarkeit der SoziologieAbstract
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auf der einen Seite eine »Metakrise« (Annalena Baerbock), eine Krise aller Krisen, auf der anderen Seite eine Soziologie, die über »polarisierte Welten« streitet. Entsprechen sich die beiden Diagnosen? Sind die Krisen in eine Krise geraten, die herkömmliche Formen ihrer Bewältigung außer Kraft setzt? Verhindert die Polarisierung jegliches Verfahren der Verständigung auf aussichtsreiche Lösungen?
Sicher scheint mir, dass die Soziologie mit ihren herkömmlichen Theorien und Methoden nur wenig zu einer Gesellschaft beitragen kann, die Krieg, Hitze, Dürre, Pandemie und kommunikativen Blockaden zwar nicht wehrlos ausgeliefert (pragmatische Lösungsversuche ebenso wie pragmatische Lösungsblockaden gibt es in Hülle und Fülle), aber doch von der Typik der Probleme konzeptionell überfordert ist. Sowohl die empirische Sozialforschung als auch die intellektuellen Entwürfe der soziologischen Theorie beschränken sich darauf, bereits bekannte Befunde zu bestätigen. Es mangelt dieser Gesellschaft nicht an Selbsterkenntnis und Selbstbeschreibung, auch wenn unklar ist, was daraus folgt.
Ein Editorial ist kein Wunschkonzert, doch ich komme nicht umhin, mir eine institutionelle, ja organisatorische Antwort der Soziologie auf die Metakrise vorzustellen: eine Soziologie in neuen Formaten der Lehre und Forschung. Ich bin erstens überzeugt, dass die Soziologie ihre internationalen Kontakte auf allen Ebenen und für alle denkbaren Themen, von der Demokratie- und Bürokratieforschung über die Industrie- und Arbeitssoziologie bis zur Kunst-, Religions- und Sportsoziologie ausbauen muss. Ich bin ebenfalls überzeugt, dass wir den Stellenwert der Soziologie hierzulande nur stärken können, wenn wir durch internationale Kooperationen mit Kolleg:innen weltweit – nicht nur im »Westen«, sondern im globalen Süden, Osten und Norden – in den Austausch gehen. Auch wenn hier schon viel passiert, kann die Sichtbarkeit weniger in der Forschung als vielmehr in der Gesellschaft durchaus noch verbessert werden.
Die mangelnde Sichtbarkeit ist die Achillesferse der Soziologie. Wir brauchen deswegen zweitens auf der Suche nach neuen Formaten eine Kampagne zur Neugestaltung unserer Fakultäten und Departments. Ich stelle mir vor, zwei, wenn nicht drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Nachwuchsförderung, Studierendenmarketing und neue Themen. Diese eine Klappe ist der massive Ausbau der Promotionsförderung. Doktorand:innen werden dafür bezahlt, die eine Hälfte ihrer Zeit an ihrer Dissertation zu arbeiten und die andere Hälfte als Tutor:innen studentische Arbeitsgruppen bei ihrer Auseinandersetzung mit praktischen Themen zu begleiten. Der Schwerpunkt der studentischen Lehre liegt auf Praxisprojekten mit Praxispartnern, in allen Bereichen der Gesellschaft. Die Universität ist der Ort, an dem nach Alternativen für jede nur denkbare gesellschaftliche Praxis gesucht wird – und sei es nur, um über diese Praxis streiten zu können und in dieser Praxis mit kritischen Impulsen wirksam werden zu können. Die Universität wird für Studierende attraktiv, weil sie hier nicht nur mit einem Fach, sondern mit der Gesellschaft konfrontiert werden. Und sie wird für Praxispartner attraktiv, weil sie hier zu einer Reflexion eingeladen werden, für die in der alltäglichen Arbeit die Zeit fehlt.
Der professorale Lehrkörper beobachtet – und reagiert seinerseits mit Themen, Ideen, Theorien und Methoden. Der Nachwuchs beendet mit der Promotion seine Ausbildung und bewirbt sich anschließend um unbefristete Lecturer- und Fellow-Stellen (interessant, dass es für diese Form der Anstellung noch nicht einmal ein deutsches Wort zu geben scheint), die auskömmlich genug die weitere Forschung, eventuelle Familiengründung und den Wettbewerb um besser bezahlte Professorenstellen ermöglichen.
Gegenwärtig übt sich die Soziologie in einem gepflegten Hegelianismus: Die Wirklichkeit ist entweder vernünftig oder unvernünftig, am liebsten jedoch beides zugleich. Es käme jedoch darauf an, ein Alternativenwissen zu erarbeiten, das sowohl positiv als auch kritisch, vor allem jedoch praktisch ist. Die Sichtbarkeit der Soziologie lässt sich nur verbessern, wenn sowohl die Universität als auch die Praxis an ihren Berührungsängsten arbeitet. Studierende stellen sich dann von allein ein (Saysches Gesetz: Das Angebot schafft sich seine Nachfrage) und Doktorand:innen haben die Wahl, ob sie anschließend an der Universität oder auf anderen beruflichen Feldern arbeiten.
Mit herzlichen Grüßen
Dirk Baecker