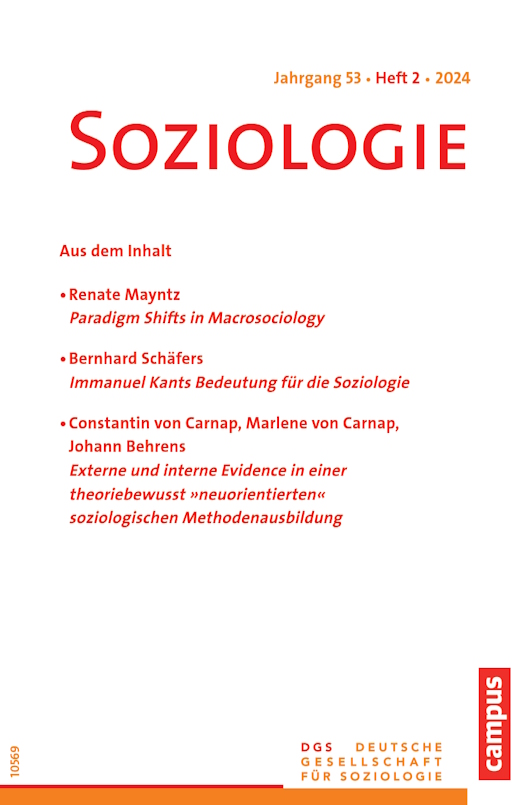Editorial
Keywords:
Krieg, VerteidigungAbstract
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Dieses Diktum des preußischen Generalmajors Carl von Clausewitz aus seiner Schrift Vom Kriege ist bekannt. Schon weniger bekannt ist sein Hinweis, dass diese »anderen Mittel« dazu neigen, sich zu verselbständigen und die Politik zu absorbieren. Und nahezu vergessen ist seine »philosophische« Definition, dass der Krieg erst mit der Verteidigung entsteht. Denn die Verteidigung will den Kampf, während der Angreifer nur die Eroberung und danach den Frieden will.
Diese Einschätzung bestätigt sich in der Ukraine wie in Israel. Russlands »militärische Spezialoperation« zielt auf nichts als die Unterwerfung; der Angriff der Hamas wollte nichts als den Terror, was immer man damit zu erreichen glaubt. Die Ukraine ebenso wie Israel haben zu ihrer Verteidigung den Kampf und damit den Krieg gewählt. Erst in zweiter Linie behauptet Russland, sich gegen den Westen und die NATO zu verteidigen, und behauptet die Hamas, sich gegen die Besatzung zu verteidigen. Im Effekt wollen alle den Krieg – und alle den Frieden, wenn auch jeweils zu ihren Bedingungen.
Den »Nebel« des Krieges, von dem Clausewitz schreibt, gibt es somit nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in der Semantik, mit der Ausbruch und Verlauf des Krieges beschrieben werden.
Diese Semantik ist jedoch entscheidend, wenn es darum geht, die politische Kontrolle über die »anderen Mittel«, über die Waffen und den Tod, die Zerstörung und Vernichtung, zu behalten. René Girard behauptet in seinem Versuch, Clausewitz »zu Ende zu denken« (2007), dass von Clausewitz nicht den Mut gehabt hätte, seine wichtigste Entdeckung ernst zu nehmen: die im Krieg angelegte, von keiner Politik zu bremsende, sondern sie ganz im Gegenteil einvernehmende Steigerung der »explodierenden Kräfte« bis zum Äußersten. Doch es gibt bei von Clausewitz auch Anhaltspunkte für eine weniger unaufhaltsame Entwicklung. Der Krieg habe keine eigene Logik, schreibt er, sondern nur eine eigene Grammatik. Er bleibe damit ein Instrument der Politik. Der Krieg sei »ein Gebiet des gesellschaftlichen Lebens«, in dem drei Kräfte aufeinandertreffen, deren Auseinandersetzung seinen Verlauf bestimme: Volk, Heer und Regierung. Jede dieser drei Kräfte liefert einen Ansatzpunkt für eine soziologische Analyse – ganz zu schweigen von ihrem Zusammenspiel und den »Friktionen«, denen nicht nur das Heer auf dem Schlachtfeld unterliegt. Das »Volk« steht bei von Clausewitz für die Leidenschaft, darunter den Hass und die Feindschaft, mit der ein Krieg verfolgt wird. Das »Heer« steht für das »Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Zufalls«. Innerhalb dieses Spiels entfalten sich Strategie und Taktik, Mut und Talent der Feldherrn. Und die »Regierung« steht für die politischen Zwecke, die verfolgt werden, während die Soldaten auf dem Schlachtfeld sterben.
Mir scheint, dass sich an der »wunderlichen Dreifaltigkeit« von Leidenschaft, freiem Willen und bloßem Verstand nicht sehr viel geändert hat, auch wenn unsere Sprache nicht mehr die des 19. Jahrhunderts ist. Das Volk wird zum Gegenstand von massenmedial verstärkter Demagogie, das Heer zum Outlet der Waffenindustrie, worauf bereits Helmuth Plessner hingewiesen hat,[1] und die Regierung zum Spielball ihres Interesses am Selbsterhalt. Damit sind drei Ansatzpunkte definiert, die soziologisch beschrieben werden können. Welche Rolle spielt die Bevölkerung? Welche Interessen verfolgt die Industrie? Und welche Entscheidungen trifft die Regierung?
Es ist ebenso ernüchternd wie ermutigend, zu sehen, dass der Krieg gesellschaftlich eingebettet ist. Er ist keine Naturgewalt, geschweige denn ein Ausdruck des Bösen, sondern ein Vektor in einem Feld komplexer Kräfte. Wir werden darüber wieder häufiger diskutieren müssen. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass auch unsere Beschreibungen und Berichte eine Rolle spielen.
Mit herzlichen Grüßen
Dirk Baecker
[1] Siehe Helmuth Plessner: Über das gegenwärtige Verhältnis zwischen Krieg und Frieden. In Ders., Macht und menschliche Natur. Gesammelte Schriften V, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, 235–257.