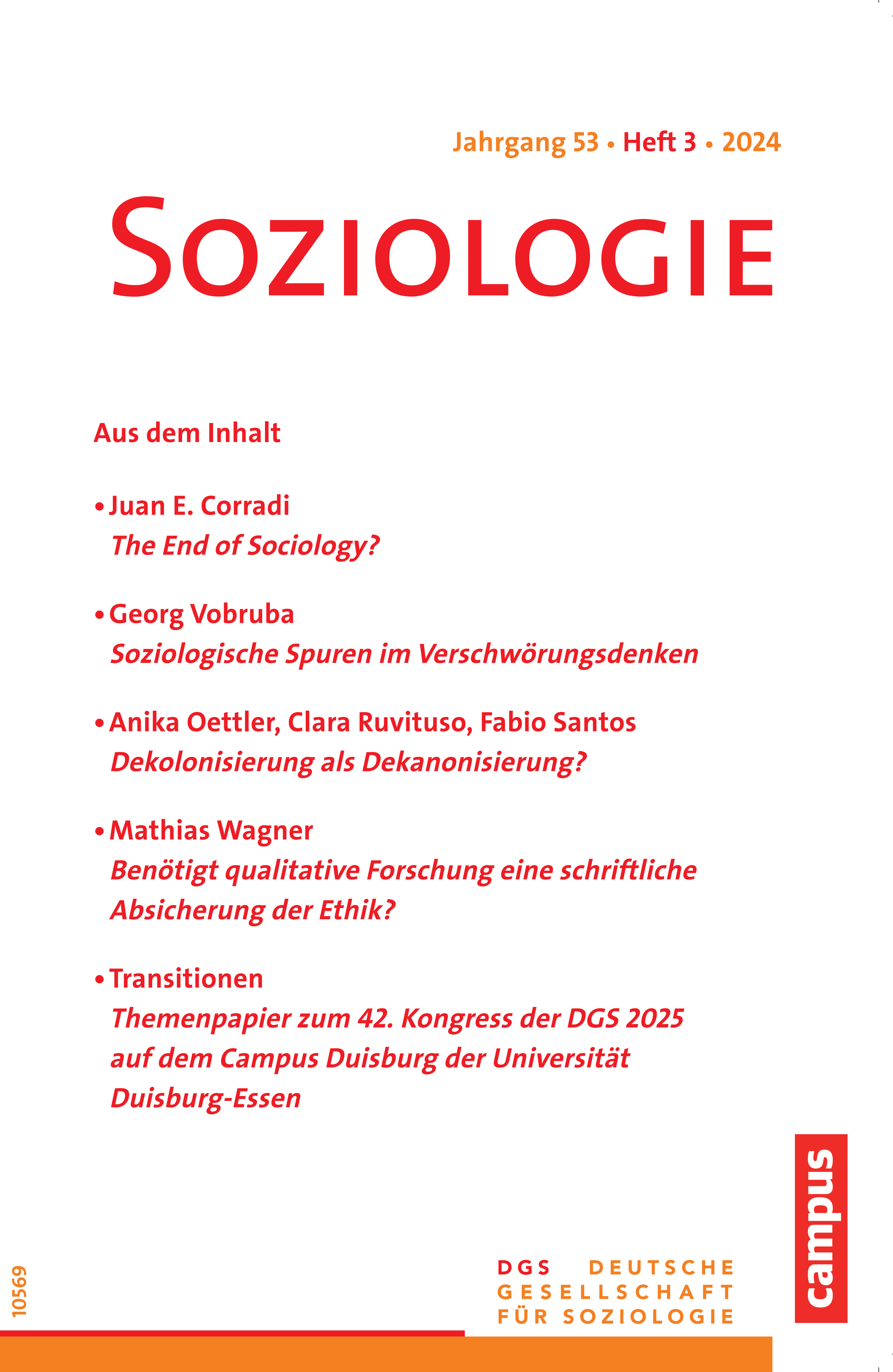Editorial
Schlagworte:
Krieg, digitale WeltAbstract
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist immer noch Krieg. Doch was ist ein Krieg? Zu Dutzenden, Hunderten, Tausenden sterben die Menschen, Soldaten ebenso wie Zivilisten. Städte werden zerstört, die Erde wird verwüstet, Flüsse werden vergiftet. Soziale Systeme sind irritiert, Netzwerke kämpfen um ihre Identität, Felder sortieren ihre Kräfte. Das Immunsystem der Gesellschaft bekämpft das Nein des Kriegs mit einem Nein zum Krieg. Alle Aufregung in Politik und Öffentlichkeit dient der Unterscheidung des einen Neins vom anderen, doch infiziert vom Krieg sind beide.
Es ist nicht lange her, dass man auch vom Krieg erwartet hat, dass er in einer ›digitalisierten‹ Gesellschaft smarter wird als je zuvor. Präzise und schnelle Eingriffe schalten Kommandozentralen aus, bevor die Truppen auch nur in Bewegung gesetzt werden können. Dem ist jedoch nicht so. Ungeheure Massen an Personal und Material kommen zum Einsatz, ›dumme‹ Bomben töten Zivilisten, Schützengräben werden gegraben, die einen monate- und jahrelangen Belagerungs- und Zermürbungskrieg ankündigen. Natürlich sind auch Drohnen im Einsatz und es werden digitalisierte Daten berechnet. Aber weder im Gazastreifen noch in der Ukraine hätten die Soldaten, Offiziere und Generäle vergangener Kriege Schwierigkeiten sich zurechtzufinden. David J. Betz, Professor of War in the Modern World am King’s College in London, weist darauf hin, dass ganz im Gegenteil ein schneller Krieg wie der Krieg der USA gegen den Irak im Frühjahr 2003, der nach drei Wochen auch dank der Bestechung irakischer Offiziere durch die CIA entschieden war, das Risiko eingeht, dass der Gegner nicht mitbekommt, dass der Krieg bereits verloren ist. Ohne die Niederlage des Gegners gibt es jedoch auch keinen Sieg des Siegers, wie die bis 2011 währende bürgerkriegsähnlichen Kämpfe irakischer Gruppen untereinander und gegen die Besatzung beweisen. Die Schätzungen ziviler Opfer bis 2011 reichen von Hunderttausend bis zu einer Million Menschen.
Die Nationalismen der modernen Welt dominieren die Kalküle einer digitalisierten Welt. Nicht die Drohung mit einer Steigerung der militärischen Mittel zählt, sondern die schiere Masse an Vernichtung. Und auch Zerstörung, Verwüstung und Tote zählen nicht, solange Systeme, Netzwerke und Kraftfelder intakt sind. Der Krieg endet erst, wenn er unter den Lebenden keinen Rückhalt mehr findet. Aber solange um politischen Einfluss gekämpft wird, militärische Optionen vorhanden sind, Waffengeschäfte gemacht werden, religiöser Eifer eine Chance hat und Massenmedien für Information und Desinformation genutzt werden können, findet der Krieg kein Ende. Die Gesellschaft reproduziert sich auch im Medium des Kriegs. Behörden und Unternehmen, Armeen und Kirchen, Krankenhäuser und Redaktionen arbeiten, solange sich Lebende finden, die sich an der Kommunikation beteiligen, und solange eine Infrastruktur existiert, die diese Kommunikation ermöglicht. Tote werden nicht nur in Kauf genommen, als ›ökologische‹ Effekte in der Umwelt der Systeme hingenommen, sondern von Politik und Militär aktiv produziert. Von »destruktiver Arbeit« sprach Lars Clausen in den 1980er Jahren.
Der Krieg ist das neue Normal. Es ist mit dem alten Normal nicht zu verwechseln. Der Krieg infiziert jede Erwartungsstruktur jeden Systems, jeden Netzwerks und jeden Kräftefelds. Auch wenn man nicht an der Front kämpft und die Kameradinnen und Kameraden neben sich fallen sieht, rechnet man mit Opfern. Jede Kommunikation bekommt diesen zusätzlichen Aspekt, dass sie noch möglich ist. Geschickt lenkt die Propaganda einen Großteil der Aufmerksamkeit auf jene, die als Gegner für die Fragilität verantwortlich gemacht werden. Das Gift der einen, die Todesangst, ist das Elixier der anderen.
Es gibt keine Gleichgültigkeit gegenüber den Toten. Sie werden betrauert, verschwiegen und instrumentalisiert. Sie konfrontieren die Gesellschaft mit einem Ende (der Menschen), das (in der Kommunikation) nicht stattfindet. Das ist der Krieg, eine fortgesetzte Produktion (›Autopoiesis‹) von Enden. Könnte man sich den Schmerz und die Trauer eingestehen, ohne zur Rache aufzurufen oder einen Nutzen aus dem Betrieb zu ziehen, der die Toten in Kauf nimmt, wäre man auf dem Weg zu einem Frieden – einem Frieden der Einsicht in die Gefährlichkeit, Unbarmherzigkeit und Brutalität mächtiger Prozesse der Vergesellschaftung.
Mit herzlichen Grüßen
Dirk Baecker