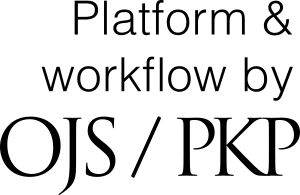Editorial
Abstract
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
man darf bezweifeln, ob sich die Situation der Soziologie seit den 1980er Jahren nennenswert verändert hat, in denen Niklas Luhmann den Mangel an einer facheinheitlichen Theorie bedauert hat. Vermutlich sind inzwischen alle Soziolog:innen, die an die Möglichkeit einer einheitlichen Theorie glauben, in der Akademie für Soziologie versammelt, während die Deutsche Gesellschaft für Soziologie die Heimat derer ist, die unter diesem Mangel nicht leiden, sondern ihn vielleicht sogar begrüßen. Pluralität als Ausweis einer komplexen Welt, sagen die einen; mangelnde Fähigkeit, Redundanz zu erkennen und zu beschreiben, sagen die anderen.
Jüngst machte ein Forschungsansatz auf sich aufmerksam, der die Karten ein weiteres Mal neu zu mischen verspricht, die sogenannte Netzwerkökologie. Hier wird versucht, woran man kaum noch zu glauben wagte, nämlich eine Integration von Netzwerkanalyse, Netzwerktheorie und Systemtheorie unter Einschluss, auch das noch, der Evolutionstheorie. Malte Döhne, Daniel A. McFarland und James Moody haben 2024 in der Zeitschrift Social Networks ein Schwerpunktheft herausgegeben, das diese Tendenz eindrucksvoll dokumentiert. Andere sprechen schon seit den 1980er Jahren von einer »post-normal science« und meinen damit eine Wissenschaft, die sich mit komplexen Phänomenen der Selbstorganisation beschäftigt, die weder mit den Mitteln einer Ursache/Wirkungs-Forschung noch mit statistischen Methoden verstanden und beschrieben werden können.
Neuen Aufschwung erhält dieser Ansatz aus dem Rückgriff auf einen noch älteren Gedanken. In den 1960er Jahren hat Herbert A. Simon eine »Architektur der Komplexität« beschrieben, in der eine »Hierarchie« ineinander verschachtelter Systeme, eine sogenannte Inklusionshierarchie, eine entscheidende Rolle spielt. Damit waren schon häufiger Überlegungen verbunden, die verschiedenen Ebenen der Selbstorganisation von Atomen, Molekülen, Zellen, Prokaryoten, Eukaryoten, Organismen, Bewusstsein und Gesellschaft als hierarchisch geordnete Ebenen der Emergenz immer wieder neuer Formen von »Natur« zu verstehen. Auf diesen beruhigenden Gedanken einer wohlgeordneten Hierarchie verzichtet die Netzwerkökologie. Sie setzt den Gedanken der Hierarchie nicht zwischen, sondern innerhalb der Systeme ein und unterscheidet mindestens drei Systemebenen: Mikrodiversität auf der untersten Ebene, selektive Strukturen auf der mittleren Ebene und so etwas wie ein Plan, ein Zweck oder auch variable Werte auf der obersten Ebene. Man denke auch an Talcott Parsons’ »kybernetische Hierarchie« einer Verschaltung von Information und Energie, die immer noch ihrer theoretischen Auslegung harrt. In der Netzwerkökologie werden diesen Ebenen keine festen Strukturen, sondern zeitliche Dynamiken zugeordnet, so dass man hohe Frequenzen von systemerhaltenden Ereignissen auf der untersten, mittlere Frequenzen auf der mittleren und niedrige Frequenzen auf der obersten Ebene unterscheiden kann. Und schon Simon entschuldigte sich: »I am sorry that high ›frequencies‹ correspond to low ›levels‹, but it can’t be helped.«
Zwischen diesen Ebenen hat man es mit den üblichen evolutionären Prozessen zu tun und das System insgesamt befindet sich in einer laufenden, natürlich nicht-linearen Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, insoweit sich diese auf allen drei Ebenen je unterschiedlich darstellt. Die Rückkopplungen zwischen den drei Ebenen können als Streit um die Bewertung unterschiedlicher Umweltwahrnehmungen verstanden werden; und an diesem Streit setzen Gedächtnisleistungen an.
Ich unterstreiche diesen Gedanken einer Netzwerkökologie, weil das Konzept einer Hierarchie von Systemebenen zwar dem modernen Theoriegeschmack zuwiderläuft, aber jedes Potential hat, empirische und theoretische, strukturelle und kulturelle, mikro-, meso- und makrosoziologische Aspekte der soziologischen Forschung zu integrieren. Der einzige Haken an der Sache ist, dass man sich auf die Idee einer Selbstorganisation komplexer Phänomene einlassen muss. Denn dass Atome, Moleküle, Zellen, Organismen, Gehirne, Bewusstsein und Gesellschaft »über sich« mehr wissen, als ein Beobachter erkennen kann, fällt immer noch schwer zu akzeptieren.
Mit herzlichen Grüßen
Dirk Baecker