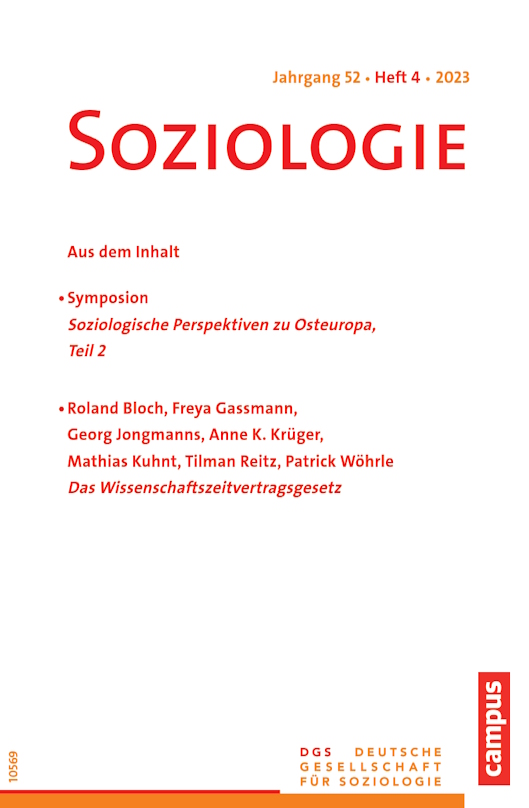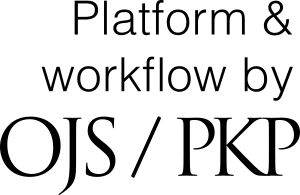Editorial
Schlagworte:
Krisen, Krisenwissenschaft, Krieg, OsteuropaAbstract
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist nicht das freundlichste Bild, das unser zweiteiliges Symposion zu Osteuropa im Kontext des Ukrainekriegs von der deutschen Soziologie entwirft. Wir haben die russische Aggression ebenso wenig vorhergesehen wie die Fähigkeit der ukrainischen Gesellschaft zur Selbstverteidigung. Wir stehen ebenso ratlos vor den totalitären Strukturen Russlands wie vor der zivilgesellschaftlichen Transformation der Ukraine. Wir halten unser Fach für eine »Krisenwissenschaft«, so Susann Worschech in ihren einleitenden Bemerkungen, doch wissen wir weder, wie Gesellschaften in die Krise rutschen, noch, wie sie wieder herauskommen. Die Krise ist für uns der Normalzustand und damit inhaltlich sowohl über- als auch unterbestimmt. Von welchen Zuständen der Gesellschaft wäre die Krise zu unterscheiden? Gibt es die Nicht-Krise? Ist sie der restlos unbestimmte Zustand, in dem wir uns auf unseren (im besten Fall unbefristeten) Stellen sicher wähnen? Stimmt die These von Klaus Schlichte, dass sich die (deutsche) Soziologie habituell und normativ in einem »juste milieu« eingerichtet hat, das seinen Wohlstand pflegt, während der Weltzustand eine einzige schlechte Nachricht ist? Und was folgt daraus, wenn diese These stimmt? Welche Dringlichkeit ließe sich aus ihr ableiten? Mehr Kooperationen mit Soziologieinstituten weltweit?
Das westliche Europa, so hat Manuela Boatcă bei anderer Gelegenheit gezeigt,[1] ist im Verhältnis zu seiner ›Peripherie‹, zu Südeuropa, Osteuropa, seinen ehemaligen und, nicht zu vergessen, seinen aktuellen Kolonien die »unmarkierte Kategorie«. Europa wird als Exempel einer demokratisch industrialisierten Moderne unter Einschluss von ein paar Problemen der Ungleichheit, der Armut und der Exklusion vorausgesetzt. Und dies gelte a fortiori für die Wissenschaft der Gesellschaft dieses Kontinents. In der Beschreibung dieser demokratisch industrialisierten Moderne herrscht eine Normalität, die paradoxerweise den restlichen Weltzustand zum leicht gruseligen Exempel einer entweder exotisch unverstandenen oder folkloristisch gezähmten Konfiguration von Gesellschaft macht. Wir verstehen uns nicht, so die These, weil wir andere Formen von Gesellschaft nicht verstehen.
So passen, wie Valeria Korablyova in ihrem Beitrag in Heft 3 beschrieben hat, die memory studies zur Rolle und zum Schicksal der Ukraine im 2. Weltkrieg und im Stalinismus bestens in das Interesse (West-)Europas an sich selbst, während jedoch die aktuellen Auseinandersetzungen einer jungen Zivilgesellschaft mit einer oligarchischen Politik schon deswegen übersehen werden, weil man kaum einen Begriff dafür hat, wie Politik zivilgesellschaftlich neu formatiert werden kann. Und natürlich weiß man, dass auch in der Ukraine die LGBTQI+-Szene um ihre Anerkennung kämpft, doch was versteht man, wie Tamara Martsenyuk in ihrem Beitrag fragt, von der Bedeutung einer öffnenden Genderpolitik für die Akzeptanz einer allgemeinen gesellschaftlichen Offenheit? Offenheit wofür? Zukunft, Handel, Dissens? Welchen Sinn haben wir für die Selbstirritation einer Gesellschaft, die in allen Fragen der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Erziehung, Kunst und Religion traditionell formatiert ist, aber in jedem dieser Bereiche dem weltgesellschaftlichen Vergleich mit anderen Möglichkeiten ausgesetzt ist? Ist der Sowjetmensch, der sich brutal oder unterwürfig an den Gewaltinstitutionen der Armee, der Polizei und der Geheimdienste orientiert, wie Evelyn Moser schreibt, nicht hierzulande ebenso wie in Russland das Phantasma, das sich praktisch wie theoretisch vor jedes angemessene Menschenbild schiebt?
Es ist nicht nur der Krieg, der uns erschreckt. Wir erschrecken auch darüber, dass wir zu verstehen beginnen, wie wenig wir uns verstehen, behütet, wie wir sind, auf der unmarkierten Seite der Geschichte. Unsere Theorien der Weltgesellschaft haben es uns erspart, Rassismus, Imperialismus, Kolonialismus, Faschismus und Sexismus für etwas anderes als randständige Phänomene zu halten. Welche Rollen-, Handlungs-, Kommunikations-, System-, Spiel-, Feld- und Netzwerktheorien haben wir von diesen Störungen der prästabilierten Harmonie der Moderne? Wir halten sie uns als Fakten vom Leibe. Und doch zeigt unser Symposion, dass wir beginnen, an der Peripherie unseres Kontinents, also überall, empirische Phänomene zur Kenntnis zu nehmen, die soziologisch begriffen werden wollen. Ein erster Schritt, Ihr ahnt es, ist eine Theorie der Markierung, die den Beobachter nicht übersieht, der so gern im Hintergrund bleibt.
Mit herzlichen Grüßen
Dirk Baecker
[1] »Thinking Europe Otherwise«. Current Sociology, vol. 69, no. 3, 2020.